Mitmacht-Festival 2025
Das Programm
Lerne das Programm des zweiten Mitmacht-Festivals kennen.
„Herzlich Willkommen bei Mitmacht 2025!“
Soft-Opening mit Kaffee, Kuchen und Kennenlernen: Gemeinsam starten wir ins Festival, mit dem Radioballett „Wohlstandsparadox“ und dem Pub-Quiz „Kollektive Intelligenz“.
Das Mitmacht-Festival startet mit einem Soft-Opening am Mittwochnachmittag. Bei Kaffee und Kuchen gibt es ein gemütliches Ankommen und erstes Kennenlernen der Festival-Teilnehmenden. Von dem Faktor D-Team erhaltet ihr am Check-in Desk alle notwendigen Informationen und Materialien für die kommenden Tage.
Um ungefähr 15:00 Uhr startet Isabell Kolditz vom Körperfunkkollektiv mit dem „Wohlstandsparadox“. Das Stück hinterfragt in Form eines Radioballetts, wie Reichtum und Armut in einem wohlhabenden Land definiert und wahrgenommen werden. Es regt dazu an, über gesellschaftliche Wertvorstellungen und die ungleiche Verteilung von Wohlstand nachzudenken. Bitte nehmt dafür euer Handy und Kopfhörer mit. Parallel dazu gibt es beim Karlsplatz bei Schönwetter eine gemeinsame kreative Straßenaktion, wo wir den (Karls-)Platz der Demokratie gestalten.
Um 16:00 Uhr startet das Pub-Quiz „Kollektive Intelligenz“. Die Teilnehmer*innen treten gegen KI-Bots an und müssen erraten, welche politischen Zitate echt und welche von der KI erfunden sind. Das Spiel möchte auf spielerische Weise Bewusstsein für Fehlinformation, Medienwandel und demokratische Diskurse schaffen.
„Kunst im Kollektiv“
Mitmacht 2025 bringt künstlerische Projekte zusammen, die Begegnungen ermöglichen und gesellschaftliche Missstände sichtbar machen.
Demokratie ist vielseitig erfahrbar. Über das ganze Mitmacht-Festival lang, wirken tolle Partner*innen und Projekte, unterschiedlich am Programm mit:
„listen&share“ ist eine begehbare Installation, die dazu einlädt, Fragen, Erfahrungen und Perspektiven gemeinsam zu erkunden. Besucher*innen hören einander zu, teilen Gedanken und gestalten so ein kollektives Bild dessen, was uns bewegt. (Gestaltet von Astrid Kirchhoff, Birger Strahl & Tobias Zucali)
Das Projekt Design Democracy setzt sich mit digitalen Postern für mehr Demokratie und Respekt im Netz ein. Gestalter*innen werden dazu aufgerufen, ihre Kunst in Form von Postern zu spenden. Design Democracy verbreitet diese Poster als visuelle Counterspeech auf Social Media, um damit einen Gegenpol zu diskriminierenden und extremistischen Inhalten zu bilden. (Gestaltet von Ravena Hengst)
Das Projekt „Demokratie, was geht?“ gibt jungen, marginalisierten Menschen Raum, ihre Gefühle und Visionen hör- und sichtbar zu machen. Bei Mitmacht gestalten Teilnehmende zwei Programmpunkte: Mit „Poetic Recording“ wird das Festival in Klang und Wort zu einer Performance verdichtet. Stimmen, Bilder, Geschichten und Stimmungen der Teilnehmenden verschmelzen zu einer lebendigen Poesie, die den Abend nachklingen lässt. (Gestaltet von Jonas Scheiner)
Die Lichtinstallation „Enlightening Stories“ zeigt auf kleinen Tafeln 3D-gedruckte Reliefbilder der Teilnehmenden. Unsichtbare Laserstrahlen tragen codierte Tonspuren – Geschichten der Jugendlichen, hörbar für alle, die aktiv zuhören. Wie auch in der Gesellschaft braucht es oft erst den bewussten Blick, um die Geschichten derer zu entdecken, die an den Rand gedrängt wurden. Hier stehen sie im Zentrum. (Gestaltet von Çağdaş Çeçen)
„Die demokratische Antwort: Ein neues Drehbuch für unsere Zeit“
Autoritäre schreiben längst an ihrem Drehbuch. Der Auftakt von Mitmacht 2025 stellt die Frage: Wie bleibt Demokratie handlungsfähig? Mit einer Keynote von Jeannette Gusko, einem Panel in Kooperation mit dem European Forum Alpbach und Raum für Austausch.
Autoritäre sind längst am Werk. Jetzt entscheidet sich, ob Demokratien den Takt vorgeben. Nach den Eröffnungsworten von Jürgen Czernohorszky ruft Jeannette Gusko zu einer neuen Kultur des Miteinanders auf, die sektorübergreifend wirkt, gemeinsame Werte trägt und kollektive Handlungsfähigkeit stärkt.
Marie Ringler eröffnet das Panel „Das autoritäre Drehbuch – und die demokratische Antwort darauf“, veranstaltet in Kooperation mit dem European Forum Alpbach. Daniel Binswanger, Natascha Strobl und Marie Ringler diskutieren, wie wir von der Analyse zu Strategien kommen, die Wirkung entfalten. Der Abend wird von Hannah Göppert moderiert, das Panel von Nina Schnider.
Im Anschluss gibt es Raum für Austausch und die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu stärken. Wer Demokratie nicht nur verteidigen, sondern gestalten will, sollte diesen Abend nicht verpassen.
Das Mitmacht-Festival startet mit diesem Abend. Organisiert von Faktor D, dem strategischen Netzwerk für Demokratie im deutschsprachigen Raum in Partnerschaft mit der Stadt Wien, der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Europäischen Forum Alpbach und Demokratie, was geht? Am Mitmacht-Festival kommen Expert*innen aus der gesamten deutschsprachigen Demokratiewelt vom 19. bis 22. November in Wien zusammen, um sich abzustimmen: Wie können wir als demokratische Kräfte zielgerichtet an einem Strang ziehen?
„Kunst im Kollektiv“
Mitmacht 2025 bringt künstlerische Projekte zusammen, die Begegnungen ermöglichen und gesellschaftliche Missstände sichtbar machen.
Demokratie ist vielseitig erfahrbar. Über das ganze Mitmacht-Festival lang, wirken tolle Partner*innen und Projekte, unterschiedlich am Programm mit:
„listen&share“ ist eine begehbare Installation, die dazu einlädt, Fragen, Erfahrungen und Perspektiven gemeinsam zu erkunden. Besucher*innen hören einander zu, teilen Gedanken und gestalten so ein kollektives Bild dessen, was uns bewegt. (Gestaltet von Astrid Kirchhoff, Birger Strahl & Tobias Zucali)
Das Projekt Design Democracy setzt sich mit digitalen Postern für mehr Demokratie und Respekt im Netz ein. Gestalter*innen werden dazu aufgerufen, ihre Kunst in Form von Postern zu spenden. Design Democracy verbreitet diese Poster als visuelle Counterspeech auf Social Media, um damit einen Gegenpol zu diskriminierenden und extremistischen Inhalten zu bilden. (Gestaltet von Ravena Hengst)
Das Projekt „Demokratie, was geht?“ gibt jungen, marginalisierten Menschen Raum, ihre Gefühle und Visionen hör- und sichtbar zu machen. Bei Mitmacht gestalten Teilnehmende zwei Programmpunkte: Mit „Poetic Recording“ wird das Festival in Klang und Wort zu einer Performance verdichtet. Stimmen, Bilder, Geschichten und Stimmungen der Teilnehmenden verschmelzen zu einer lebendigen Poesie, die den Abend nachklingen lässt. (Gestaltet von Jonas Scheiner)
Die Lichtinstallation „Enlightening Stories“ zeigt auf kleinen Tafeln 3D-gedruckte Reliefbilder der Teilnehmenden. Unsichtbare Laserstrahlen tragen codierte Tonspuren – Geschichten der Jugendlichen, hörbar für alle, die aktiv zuhören. Wie auch in der Gesellschaft braucht es oft erst den bewussten Blick, um die Geschichten derer zu entdecken, die an den Rand gedrängt wurden. Hier stehen sie im Zentrum. (Gestaltet von Çağdaş Çeçen)
„Community und Campaigning: so wird Wirkung möglich“
Wie Communities und Campaigning zusammenwirken: In Kleingruppen entstehen Strategien für berufliche Herausforderungen und wirkungsvolle Mobilisierung.
Communities und Campaigning – zwei Bereiche, die im NGO-Alltag oft noch getrennt voneinander gedacht werden. Die einen setzen auf die langfristige Beziehungspflege mit engagierten Aktivist*innen, die anderen mobilisieren für konkrete politische Ziele. Doch Wirksamkeit entsteht, wenn beides zusammenkommt: starke Kampagnen, getragen von engagierten Communities.
In dieser Session erfahrt ihr, wie dieser Schulterschluss gelingt – auch mit begrenzten Ressourcen. Ihr lernt Strategien kennen, wie sich politische Inhalte durch Amplification – also gezielte Community-Arbeit – wirkungsvoll verstärken lassen. Im Mittelpunkt stehen konkrete Umsetzungen aus der Praxis: Was funktioniert wirklich? Und was lässt sich auf andere Organisation übertragen? Im interaktiven Teil arbeitet ihr in sogenannten „Case Clinics“: Kleingruppenformate, an denen ihr reale Herausforderungen aus eurem Berufsleben einbringt – und gemeinsam Lösungsansätze entwickelt, die über den Workshop hinaus wirken
„From Collective Action to Policy Impact“
Ein Praxisbeispiel zeigt, wie zivilgesellschaftliche Akteur*innen ihre Erkenntnisse in politische Forderungen übersetzen und politische Veränderungen bewirken.
Wie können Erkenntnisse aus der Zivilgesellschaft gebündelt, aufbereitet und in wirksame politische Empfehlungen übersetzt werden? Gerade im Bereich Desinformation gibt es bereits jede Menge Forschung und Monitoring. Was oft fehlt, sind die nächsten Schritte: Erkenntnisse bündeln, politische Forderungen formulieren und gemeinsam institutionelle Veränderungen initiieren. Es braucht eine strategische zivilgesellschaftliche Linie, die sich dafür einsetzt.
In dieser Session lernt ihr ein Good-Practice Beispiel kennen, bei dem genau das gelungen ist: Die „Empfehlungen an die neue Bundesregierung für ein unabhängiges und wirksames Desinformationsmonitoring im digitalen Raum“. Denn Teile dieser Empfehlung sind in den Koalitionsvertrag der neuen deutschen Bundesregierung eingeflossen.
„Demokratie braucht Räume: Beteiligung als politische Praxis“
Lokale Beteiligung braucht Orte. Welche Formen kann das annehmen? Und wie gewinnt man Politik dafür?
Demokratie lebt vom Mitmachen – doch dafür braucht es Orte, an denen Menschen sich begegnen, einbringen und gemeinsam gestalten. Genau hier setzen die Projekte „Orte der Demokratie“ und das „Erfahrungs- und Beteiligungsnetzwerk Bürgerbeteiligung“ an: Sie schaffen Raum für politische Teilhabe, stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und fördern konkrete Vorhaben, in denen Mitbestimmung erlebbar wird. Das kann ein Chor, ein altes Postamt, Mitmachgarten oder eine Dorfbibliothek sein.
In dieser Session erfahrt ihr, warum solche Begegnungsräume besonders auf kommunaler Ebene notwendig sind, wie sie entstehen – und welche politischen Rahmenbedingungen es dafür braucht. Praxisbeispiele zeigen, wie verschiedene Zielgruppen in Beteiligungsprozesse eingebunden werden. Ideal für alle, die Beteiligung nicht nur denken, sondern aktiv gestalten wollen.
„DemocracyGPT: KI im Dienst der Demokratie“
Können KI-Agenten die Demokratie stärken? Das Projekt „DemocracyGPT” testet Prototypen, die Quellen aufbereiten, Argumente liefern und neue Sichtweisen öffnen.
Künstliche Intelligenz durchdringt zunehmend alle Lebensbereiche – doch ihr Potenzial für die Demokratie bleibt bisher weitgehend ungenutzt. Dabei könnten KI-Tools Barrieren der Partizipation senken und politische Entscheidungen fundierter machen. Das Projekt „DemocracyGPT“ entwickelt KI-Agenten, die verständlich informieren, Perspektiven sichtbar machen und zur Meinungsbildung beitragen. Im Workshop testet ihr Prototypen: Wie gut gelingt KI-gestützte Orientierung in politischen Fragen? Welche Chancen eröffnen sich, wo zeigen sich Grenzen? Und wie reagieren Menschen, wenn Maschinen beim Denken unterstützen? Ihr erlebt die Tools live, entwickelt eigene Anwendungsideen – und nehmt einen Bauplan mit, um selbst Prototypen umzusetzen.
„Raus aus der Blase - mit Strategie & Empathie“
Lebendige Demokratie braucht Beteiligung und spiegelt Vielfalt. Wie gelingt es, neue Menschen zu erreichen, vielfältiger zu werden und Brücken über die eigene Blase hinaus zu bauen?
Einladungen erreichen häufig immer wieder dieselben Menschen. Netzwerke bleiben geschlossen, Stimmen wiederholen sich – und die eigene Bubble verstärkt sich selbst. Wie lassen sich Brücken zu Menschen bauen, die bisher nicht erreicht wurden? Der Workshop bietet euch strategische und empathische Impulse sowie konkrete Werkzeuge, um vielfältige Verbündete für euer Anliegen zu gewinnen. Mit Methoden wie dem „Spektrum der Verbündeten“ und „Empathy Talk“ eröffnet ihr Zugänge zu neuen Perspektiven, kommt in Verbindung und schafft eine Basis zum Brückenbau.Hinweis: Brücken entstehen nicht in einer Stunde – doch mit Neugierde und nützlichem Werkzeug wächst Stück für Stück ein stabiles Fundament.
„Zwischen Gewinn und Gemeinwohl“
Wirtschaft und Demokratie stärken sich gegenseitig. Business Council for Democracy zeigt, wie Unternehmen Verantwortung für gesellschaftlichen Zusammenhalt übernehmen können.
Wirtschaft und Demokratie sind unverzichtbare Partner für eine wehrhafte Gesellschaft. Eine stabile Demokratie ist auf eine gesunde Wirtschaft angewiesen – und umgekehrt. Doch beide geraten zunehmend unter Druck: Globale Herausforderungen und gesellschaftliche Polarisierung erschüttern die Fundamente unseres Zusammenlebens. Es braucht neue Allianzen und ein klares Bekenntnis zu gemeinsamen Werten. In diesem Beitrag lernt ihr das Projekt Business Council for Democracy (BC4D) als Motor für mehr unternehmerische Verantwortung, Dialog und konstruktiven Streit kennen. Der BC4D motiviert Unternehmen, Haltung zu zeigen, Polarisierung entgegenzuwirken und die Debattenkultur im Betrieb zu stärken. So wird die Wirtschaft als oft unterschätzte, aber essenzielle Ressource für demokratische Resilienz aktiviert.
„Die Kraft der Dritten Orte“
Sarah Schneider stößt an: Wie können Dritte Orte zu offenen Räumen werden, die Vielfalt fördern, Konflikte aushalten und demokratischen Zusammenhalt stärken?
Wie können Begegnungsorte in polarisierten Zeiten offen, vielfältig und resilient bleiben? Dritte Orte zeigen: Demokratie wird hier praktisch erlebt. Hier treffen sich Menschen, die sonst selten in Kontakt kommen – über Generationen und Lebenswelten hinweg. Ein Beispiel dafür ist das KörberHaus in Hamburg-Bergedorf: Neun Partnerorganisationen gestalten einen Ort, an dem Engagement, Kultur und Bildung unter einem Dach zusammenfinden. Im Diskurs mit Sarah Schneider von der Körber-Stiftung geht es darum, wie solche Dritten Orte den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken können. Welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft bei ihrer Sicherung? Und welche Strategien und Allianzen braucht es, um sie dauerhaft als Räume für Vielfalt und demokratisches Lernen zu verankern?
„Vermittlung von Media Literacy in Schulen“
Im Gespräch mit Florian Schmidt von der APA: Wie können Faktenchecks und Recherchetechniken in Schulen vermittelt werden, damit Jugendliche Desinformation besser erkennen und einordnen?
Desinformation, Fake News und KI-generierte Inhalte prägen den digitalen Alltag – besonders für junge Menschen, die täglich mit einer Flut an Informationen konfrontiert sind. Während in der Faktencheck-Community seit Jahren erprobte Methoden zur Überprüfung von Quellen existieren, sind diese Techniken in der breiten Bevölkerung noch wenig bekannt. Im Diskurs mit Florian Schmidt von der Austria Presse Agentur (APA) geht es darum, wie Media Literacy frühzeitig gestärkt werden kann. Die APA entwickelt derzeit eine Lernplattform, die Lehrer*innen und Schüler*innen praxisnah an das journalistische Handwerk heranführt – von der Quellenprüfung bis zur Bildanalyse. Gemeinsam diskutieren wir, wie Jugendliche im digitalen Alltag besser unterstützt werden können, welche Kompetenzen sie für einen kritischen Umgang mit Online-Inhalten brauchen und wie Schulen zu zentralen Lernorten für digitale Mündigkeit werden können.
Pause
Zeit für Erholung.
Zeit für Erholung.
„LOS jetzt! Bürger*innenräte wollen Demokratie fördern“
Wie können ehemalige Teilnehmende eines Bürger*innenrats zu Botschafter*innen der Demokratie werden? Das Projekt „LOS jetzt“ zeigt neue Wege mit Spiel, Erfahrung und Dialog.
Wie können junge Menschen ihre Erfahrungen aus Bürger*innenräten weitertragen und andere dafür begeistern? Das Projekt „LOS jetzt“ zeigt, wie ehemalige Teilnehmende aus der Schweiz, Deutschland und Österreich neue Ideen der Vermittlung entwickelt haben. Ihr Ziel: das Losverfahren in ihrer Peer-Group und gegenüber Entscheidungsträger*innen sichtbarer zu machen. Entstanden ist ein Kartenspiel, das zentrale Elemente von Demokratie und Bürger*innenräten spielerisch vermittelt.
In diesem Beitrag testet ihr das Kartenspiel und tauscht euch mit jungen Beteiligten aus. Im gemeinsamen Dialog entwickelt ihr Ideen: Wie kann ein Alumninetzwerk wachsen? Wie können spielerische Ansätze neue Beteiligungsformate fördern? Und was können wir alle von jungen Demokraten*innen lernen?
„Web@ngels im Einsatz gegen Hass im Netz“
Hassrede bedroht Debattenkultur und Demokratie. Das Projekt Web@ngels zeigt praxisnah, wie ihr wirksam gegen Hass im Netz vorgeht.
Hassrede ist in Online-Diskussionen zur Normalität geworden – mit Folgen für Betroffene und dem demokratischen Diskurs insgesamt. Wenn sich konstruktive Stimmen zurückziehen, entsteht mehr Raum für Echokammern. Das Projekt Web@ngels zeigt, wie digitale Zivilcourage konkret aussehen kann. In einer interaktiven Session analysiert ihr in Kleingruppen reale Beispiele von Diskriminierung im Netz und entwickelt eigene Gegenredestrategien. Diese werden anschließend im Plenum diskutiert, verglichen und gemeinsam weitergedacht. Dabei schärft ihr euer Verständnis für die Dynamiken von Online-Diskriminierung, nutzt praxisnahe Methoden digitaler Zivilcourage und nehmt hilfreiche Tools für eure eigene Projekte und Initiativen mit.
„Im Visier: Angriffe auf Demokratie und Verwaltung“
Wie kann Verwaltung die freiheitlich demokratische Grundordnung schützen, ohne ihre politische Neutralität zu verlieren? Ein Erste-Hilfe-Kit gibt Antworten.
Die Demokratie in Deutschland steht zunehmend unter Druck – und auch die Verwaltung wird ins Visier genommen. Persönliche Angriffe auf Mitarbeitende, Gewaltandrohungen oder Versuche, demokratische Prozesse zu delegitimieren, sind keine Einzelfälle mehr. Gerade hier stellt sich die Frage: Wie kann Verwaltung ihre Pflicht zur Verfassungstreue klar wahrnehmen, ohne Zweifel an ihrer parteipolitischen Neutralität aufkommen zu lassen? Der Workshop stellt ein Erste-Hilfe-Kit vor – ein Instrument, das Orientierung gibt, wenn Institutionen unter Druck geraten. Ihr erarbeitet gemeinsam, wie dieses Werkzeug weiterentwickelt werden kann, um noch mehr Handlungssicherheit zu schaffen. Am Ende der Session habt ihr Anlaufstellen und Werkzeuge an der Hand, um – innerhalb oder außerhalb der Verwaltung – aktiv zur Verteidigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung beizutragen.
„Von der Diktatur in die Demokratie – ein Lernprozess?“
Geflüchtete aus Diktaturen stoßen auf Hürden der Teilhabe. Politische Bildung kann mit kultursensiblen Zugängen neue Räume öffnen und Communities stärken.
Wer aus einer Diktatur flieht, hat kaum Erfahrung mit demokratischen Strukturen und wird in Aufnahmeländern oft lange von politischer Teilhabe ausgeschlossen. Sprachbarrieren, fehlende kultursensible Angebote und schwache Netzwerke erschweren den Zugang zusätzlich – für Betroffene und Bildungsprojekte. Das Projekt „Demokratie Leben“ stärkt geflüchtete Migrant*innen in der ganzen Schweiz mit interaktiver, kultursensibler politischer Bildung in der Sprache Tigrinya. Im Workshop erfahrt ihr mehr über die Situation der eritreischen Diaspora und diskutiert anhand von Praxisbeispielen Herausforderungen und Chancen politischer Bildung in diasporischen Kontexten. Gemeinsam entwickelt ihr Transferideen für andere migrantische Communities und erarbeitet Impulse für eine bessere Vernetzung zwischen Diaspora-Organisationen und Bildungsinstitutionen.
„Campaigning 101: Gemeinsam Veränderung bewirken“
Wie können Bürger*innen Veränderungen bewirken? #aufstehen zeigt, wie zivilgesellschaftliches Campaigning demokratische Prozess anstößt und stärkt.
Demokratie lebt von einer aktiven Zivilgesellschaft. Doch wie gelingt es Bürger*innen mitzugestalten und gesellschaftliche Veränderung zu bewirken? #aufstehen stellt Good-Practices vor, die zeigen, wie zivilgesellschaftliches Campaigning demokratische Mitgestaltung ermöglicht. Ihr bekommt konkrete Strategien für wirkungsvolle Kampagnen an die Hand: zentrale Taktiken, wichtige Erfolgsfaktoren und die Frage, wie Zivilgesellschaft strategisch vorgehen kann, um demokratische Prozesse anzustoßen und mitzugestalten? Im Praxisteil entwickelt ihr eigene Kampagnenideen und erfahrt, was eine erfolgreiche Petition ausmacht. Gemeinsam erarbeitet ihr, wie digitale Tools demokratische Mitgestaltung stärken – und wie jede*r Einzelne zu einer lebendigen Demokratie beitragen kann.
„Wiener Demokratie-Strategie: Für Mitbestimmung und Zusammenhalt“
Wencke Hertzsch spricht über die Wiener Demokratie-Strategie: Wie ein breiter Beteiligungsprozess Mitbestimmung stärkt und Demokratie in einer Großstadt neu verankern kann.
Wie kann eine Großstadt mit unterschiedlichen Akteur*innen ihre Demokratie stärken? Mit der neuen Demokratie-Strategie schafft die Stadt Wien einen Rahmen, um demokratische Kultur gezielt auszubauen. Ziel ist es, möglichst vielen Wiener*innen – unabhängig von ihren Lebensrealitäten – Mitgestaltung zu ermöglichen. Die Strategie wurde, bis Frühjahr 2025 in einem offenen Beteiligungsprozess erarbeitet: mit Workshops in den Bezirken, Online-Formaten, Fachgesprächen und Veranstaltungen, die gezielt Gruppen einbanden, denen sonst selten zugehört wird. Der Entwurf wurde zudem auf der Beteiligungsplattform veröffentlicht, um Feedback aus der Bevölkerung einzuholen. Im Diskurs mit Wencke Hertzsch von der Stadt Wien geht es um die nächsten Schritte: Wie wird aus einem Strategiepapier gelebte Praxis? Und wie lässt sich Beteiligung dauerhaft in Verwaltung und Politik verankern, um Mitbestimmung, Transparenz und Zusammenhalt zu stärken?
„Wie wir im eigenen Umfeld aktiv werden können“
Katharina Jeschke zeigt, wie jede*r im eigenen Umfeld Demokratie stärken kann – vom Dialog in der Nachbarschaft bis hin zur Zusammenarbeit mit anderen Initiativen.
Gesellschaftliche Spaltung und Polarisierung nehmen zu. Viele Menschen fühlen sich nicht mehr gehört und in ihrer Lebenswelt isoliert. Das Projekt Österreich der Runden & Eckigen Tische schafft Räume für Begegnung und Verständigung. Im Diskurs mit Katharina Jeschke von Österreich der Runden & Eckigen Tische geht es um darum, wie jede*r im eigenen Umfeld aktiv werden kann. Ihr diskutiert, wie individuelle Beiträge größere Wirkung erzielen können: Welche Ressourcen lassen sich aktivieren? Was können wir voneinander lernen? Und wie kann die Zusammenarbeit mit anderen Initiativen gestärkt werden, um diesen zu fördern?
„Demokratiebildung: Game based Learning mit One Up Island“
Christian Pöltl-Dienst spricht darüber, wie Game-based Learning junge Menschen für Demokratie begeistert und politische Bildung praxisnah und spielerisch erlebbar macht.
Politikverdrossenheit wächst, und viele junge Menschen erleben demokratische Prozesse als fern und abstrakt. Game-based Learning setzt hier an: Demokratie wird nicht nur erklärt, sondern spielerisch erfahrbar. Am Beispiel von One Up Island, einem von der Arbeiterkammer Wien entwickelten Spiel, erfahrt ihr, wie demokratische Entscheidungsprozesse erlebbar werden und junge Menschen für Teilhabe begeistert werden können. Im Diskurs mit Christian Pöltl-Dienst von der Arbeitekammer Wien geht darum, wie spielerische Formate Partizipation auf Augenhöhe fördern können. Ihr diskutiert: Wie stärkt Game-based Learning demokratische Kompetenzen in der Praxis? Welche Chancen und Grenzen hat der Einsatz von Spielen in der politischen Bildung? Und wie gelingt es, Jugendliche für Demokratie zu gewinnen?
„Wem gehört der Feed?“
Andrea Laura Bonk und Leon Erlenhorst sprechen darüber, wieso extremistische Narrative auf dem digitalen Spielfeld gewinnen – und wie wir den Trend umkehren können.
Durch Hetze, Desinformation und extremistischen Content gerät unsere Demokratie auch digital mehr und mehr unter Druck. Im Diskurs mit Media Force und der DFL Stiftung geht es darum, wie sich dieser Entwicklung wirksam begegnen lässt. Andrea Laura Bonk und Leon Erlenhorst verbinden datenanalytische und inhaltlich-kreative Strategien, um digitale Räume zurückzuerobern: Durch Datenanalysen werden Verhaltensmuster von Zielgruppen sichtbar. Dieses Wissen bildet die Grundlage für die Entwicklung demokratischer Narrative und Inhalte – insbesondere dort, wo junge Menschen ihre Meinungen bilden. Ihr diskutiert gemeinsam, wie Erkenntnisse aus Forschung, Kommunikation und digitaler Praxis zusammenwirken können, um die algorithmischen Gegebenheiten zu einem Vorteil zu nutzen.
„Keynote mit Kübra Gümüşay“
Kübra Gümüşay zeigt, wie Sprache Wirklichkeiten schafft – und wie wir mit Imagination neue demokratische Zukunftsbilder entwickeln können.
Sprache ist nie neutral – sie formt, was wir sehen, denken und für möglich halten. Sie kann demokratische Räume öffnen oder verschließen, Zugehörigkeit schaffen oder verweigern. Autorin und Publizistin Kübra Gümüşay beschreibt Sprache als Instrument, das unsere Wahrnehmung prägt und den Rahmen dessen bestimmt, was wir uns als veränderbar vorstellen.In ihrer Keynote verbindet sie diese Macht der Sprache mit dem Potenzial der Imagination: der Fähigkeit, sich gerechtere, inklusivere Zukünfte vorzustellen – und sie verhandelbar zu machen.
Wer darf Zukunft entwerfen? Und wie entwickeln wir gemeinsam Narrative, die Orientierung geben und demokratisches Handeln ermöglichen? Gerade in Zeiten, in denen autoritäre Kräfte gezielt Emotionen einsetzen, lädt Kübra Gümüşay dazu ein, Sprache und Vorstellungskraft als Räume für utopisches Denken zu begreifen. So entstehen Zukunftsbilder, die Hoffnung geben und Zugehörigkeit stärken.Diese Keynote ist ein Weckruf und eine Einladung zugleich: Sie ermutigt, neu zu denken, gemeinsam zu gestalten und Zugehörigkeit möglich zu machen. Eine Einladung aus kollektiver Vorstellungskraft, demokratische Stärke zu gewinnen.
„Lab: Digitale Öffentlichkeit und Demokratie“
In diesem Lab gestalten wir Zukunftsbilder für eine digitale Öffentlichkeit, die Hass und Desinformation wirksam entgegentritt und Zusammenhalt stärkt.
Hassrede und Desinformation untergraben Vertrauen, spalten Gesellschaften und gefährden die Grundlagen demokratischer Verständigung. Im Lab Digitale Öffentlichkeit & Demokratie beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Interventionen es gegen diese Dynamiken bereits gibt – und welche neuen Strategien es braucht, um digitale Räume zu stärken. Ausgangspunkt sind bestehende Ansätze beispielsweise aus Prävention und Bildung, Regulierung, Kommunikation, Nachsorge und Analyse. Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten sichten wir, was vorhanden ist und wo noch Lücken bestehen. Das Lab wird von das NETTZ, der Vernetzungsstelle gegen Hass im Netz, gehostet, das Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik verbindet. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Kollektives Wirken und Demokratie“
In diesem Lab entstehen Zukunftsbilder, in denen Ressourcen, Wissen und Strategien gebündelt werden, um die Demokratie nachhaltig zu stärken.
Demokratische Strukturen stehen unter Druck, während gesellschaftliche Herausforderungen immer komplexer werden. Fragmentierung, Konkurrenzdenken und fehlende Abstimmung verhindern, dass Initiativen ihr volles Potenzial entfalten. Um die Demokratie zukunftsfähig zu halten, braucht es neue Formen der Zusammenarbeit über Sektorgrenzen hinweg. Wie können gemeinsame Strategien entstehen und kollektive Wirkung entfaltet? Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Kräfte gebündelt, Verantwortung geteilt und Allianzen geschaffen werden, um Veränderungen langfristig zu verankern. Das Lab wird von Phineo und Ashoka Austria gehostet – zwei Organisationen, die soziale Innovation, Wirkungsmessung und sektorübergreifende Zusammenarbeit fördern, um gemeinsames Handeln für die Demokratie zu stärken. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Beteiligung und Demokratie“
Wir bündeln Erfahrungen, um Beteiligung neu zu denken und Wege zu finden, wie sie Menschen wieder stärker verbindet.
Demokratie lebt davon, dass Menschen sich beteiligen und mitgestalten – doch vielerorts gelingt das immer weniger. Viele fühlen sich von politischen Prozessen ausgeschlossen oder werden nicht gehört. Gleichzeitig suchen Kommunen und Institutionen nach neuen Wegen, um den Dialog mit Bürger*innen zu stärken. Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten bringen wir bestehende Formate und Erfahrungen aus dem DACH-Raum zusammen, um sie zu bündeln, Synergien sichtbar zu machen und daraus gemeinsame Zukunftsbilder abzuleiten. Das Lab wird vom Schweizer Dachverband Partizipation gehostet, der sich für Qualität, Wirksamkeit und eine Kultur der Mitgestaltung in Partizipationsprozessen einsetzt. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Alltagsorte und Demokratie“
In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Alltagsorte Begegnung, Zugehörigkeit und Vertrauen in die demokratische Gesellschaft stärken.
Demokratie wird nicht nur in Parlamenten erfahrbar, sondern überall dort gelebt und verhandelt, wo Menschen sich im Alltag begegnen: im Verein, beim Einkaufen, in der Bar oder auf dem Spielplatz. Diese Orte prägen, wie wir unsere Mitmenschen und auch Demokratie erleben. Doch heute schwinden viele dieser Orte, Begegnungen werden seltener und Menschen empfinden öffentliche Räume als unsicher.Welche Orte braucht es und wie können wir sie so gestalten, dass sie gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern? In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Alltagsorte Begegnung, Zugehörigkeit und Zutrauen in die demokratische Handlungsfähigkeit und gesellschaftliche Zukunftsgestaltung stärken. Das Lab wird von More in Common gehostet, einer Organisation, die erforscht, was Gesellschaften zusammenhält und wie Vertrauen und Zugehörigkeit demokratischen Gesellschaften gestärkt werden können. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsler erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Emotionen & Demokratie“
In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Emotionen als demokratische Kraft wirken – und wir so autoritären Tendenzen wirkungsvoll entgegentreten.
Autoritarismus überzeugt nicht mit Argumenten und Programmen, sondern agiert tiefer. Er kreiert mächtige kollektive Affekte und kanalisiert (un)bewusste Wünsche und Ängste. Demokratien reagieren darauf oft rational – mit Programm, Struktur und Appell. Doch ohne ein Verständnis der tief liegenden Affektdynamiken bleibt ihre Wirkung begrenzt. Unter welchen Bedingungen sind eine lebenswerte Zukunft und demokratische Ideale wieder vorstellbar? Fachexpert*innen und Interessierte erkunden gemeinsam, welche Rolle Emotionen in der Politik spielen und entwickeln strategische Ansatzpunkte, wie dieses Wissen gezielt in demokratische Bildungs-, Kommunikations- und Beteiligungsprozesse einfließen kann. Das Lab wird von Beyond Molotovs gehostet, einem Kollektiv, das sich seit 2020 mit anti-autoritären Gegenstrategien beschäftigt. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Fuckup Night“
Offene Fehlerkultur schafft Vertrauen, ermöglicht mutiges Ausprobieren und wertvolle Erfahrungen. Bei der Fuckup Night teilen drei Teilnehmende ihre größten Learnings.
Eine offene Fehlerkultur ermöglicht es Menschen, Neues auszuprobieren, Risiken einzugehen und Erfahrungen zu teilen – ohne Angst, verurteilt zu werden. Fehler sind kein Zeichen von Schwäche, sondern die Basis und der Antrieb für Entwicklung und Veränderung. Auch wenn der Begriff der offenen Fehlerkultur nicht unbekannt ist, bleibt man hinter den Überschriften oft an der Oberfläche. Für echten Tiefgang braucht es eine vertrauensvolle Basis, die auch das gegenseitige Auffangen einschließt. Denn im Prozess der Auseinandersetzung werden Emotionen freigesetzt, die wir oft nicht erwarten. Erfahrungen an andere weiterzugeben bedeutet auch, den Wert des Erlebten zu erkennen. Da in unserer schnelllebigen Zeit die Reflexion zu kurz kommt, hat ihr Wert unheimlich zugenommen.
Bei der Fuckup Night berichten drei Festival-Teilnehmende in maximal 10 Minuten von ihren Erlebnissen, Fehlern und vor allem ihren Learnings. Wir freuen uns auf Geschichten von Katja Meier, Christian Pöltl-Dienst und Flurina Wäspi.
„Kunst im Kollektiv“
Mitmacht 2025 bringt künstlerische Projekte zusammen, die Begegnungen ermöglichen und gesellschaftliche Missstände sichtbar machen.
Demokratie ist vielseitig erfahrbar. Über das ganze Mitmacht-Festival lang, wirken tolle Partner*innen und Projekte, unterschiedlich am Programm mit:
„listen&share“ ist eine begehbare Installation, die dazu einlädt, Fragen, Erfahrungen und Perspektiven gemeinsam zu erkunden. Besucher*innen hören einander zu, teilen Gedanken und gestalten so ein kollektives Bild dessen, was uns bewegt. (Gestaltet von Astrid Kirchhoff, Birger Strahl & Tobias Zucali)
Das Projekt Design Democracy setzt sich mit digitalen Postern für mehr Demokratie und Respekt im Netz ein. Gestalter*innen werden dazu aufgerufen, ihre Kunst in Form von Postern zu spenden. Design Democracy verbreitet diese Poster als visuelle Counterspeech auf Social Media, um damit einen Gegenpol zu diskriminierenden und extremistischen Inhalten zu bilden. (Gestaltet von Ravena Hengst)
Das Projekt „Demokratie, was geht?“ gibt jungen, marginalisierten Menschen Raum, ihre Gefühle und Visionen hör- und sichtbar zu machen. Bei Mitmacht gestalten Teilnehmende zwei Programmpunkte: Mit „Poetic Recording“ wird das Festival in Klang und Wort zu einer Performance verdichtet. Stimmen, Bilder, Geschichten und Stimmungen der Teilnehmenden verschmelzen zu einer lebendigen Poesie, die den Abend nachklingen lässt. (Gestaltet von Jonas Scheiner)
Die Lichtinstallation „Enlightening Stories“ zeigt auf kleinen Tafeln 3D-gedruckte Reliefbilder der Teilnehmenden. Unsichtbare Laserstrahlen tragen codierte Tonspuren – Geschichten der Jugendlichen, hörbar für alle, die aktiv zuhören. Wie auch in der Gesellschaft braucht es oft erst den bewussten Blick, um die Geschichten derer zu entdecken, die an den Rand gedrängt wurden. Hier stehen sie im Zentrum. (Gestaltet von Çağdaş Çeçen)
„Panel: Mut zur Hoffnung“
Krisen erzeugen Angst und Ohnmacht – diese Gefühle können auch anders wirken. Dieses Panel zeigt, wie Emotionen als demokratische Ressourcen genutzt werden können.
Krisen unserer Zeit erzeugen Angst, Wut und Ohnmacht – Emotionen, die von antidemokratischen Kräften gezielt als Treibstoff genutzt werden. Während sie mit starken Gefühlen mobilisieren, bleiben demokratische Akteur*innen hingegen meist reaktiv und nutzen das Potenzial (positiver) Emotionen kaum strategisch. Das Panel liefert konkrete Antworten: Was wäre, wenn wir wieder pro-demokratische Zukunftsbilder entwerfen und daraus neue Hoffnung schöpfen? Wenn wir anerkennen, dass Demokratie und Emotionen untrennbar verbunden sind – und dass gerade Hoffnung Orientierung gibt, langfristig bindet und kollektive Handlungsfähigkeit stärkt? Und wie lässt sich Emotionalisierung bewusst als demokratische Kraft nutzen – für eine Kultur der Hoffnung statt der Angst?
Im Fokus steht die Analyse politischer Emotionen und demokratischer Diskurse. Wir teilen Erfahrungen aus zivilgesellschaftlicher Mobilisierung und fragen, wie Hoffnung in gesellschaftliche Transformation übersetzt werden kann – in Sprache, Narrativen und Kampagnen. Dahinter steht die Idee einer demokratischen Emotionskultur, die zeigt: Gefühle können Demokratie stark machen.
Das Panel wir moderiert von Florian Schmidt (Austria Presse Agentur).
„Das österreichische Parlament auf TikTok & Co.“
Politik auf Social Media erklären, das macht der Newsroom des Parlaments seit drei Jahren. Zwei Redakteurinnen zeigen, warum es um mehr geht als nur „Likes“.
Das österreichische Parlament zeigt, wie Demokratiebildung funktionieren kann: Es bringt sie dorthin, wo viele Menschen den Großteil ihres Alltags verbringen: auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. Junge Menschen lernen über Demokratie und Parlamentarismus – und das nahbar und in einer Sprache, die ankommt. Wie erklärt man komplexe Inhalte in 90 Sekunden? Welche Fragen stellen Bürger*innen in TikTok-Livestreams zu Nationalratssitzungen? Was hat das österreichische Parlament in drei Jahren Demokratiebildung auf Social Media gelernt?
Ihr erfahrt, warum das Parlament auf der Plattform TikTok ist, welche Inhalte besonders gut funktionieren – und warum Likes nicht das einzige Ziel sind, wenn man demokratische Teilhabe fördern will.
„Wenn Engagement unter Druck gerät“
Autoritäre Einstellungen gibt es auch in der Zivilgesellschaft. Wo treten sie auf, wer ist betroffen und wie können wir die demokratische Zivilgesellschaft stärken?
Zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen tragen zu einer starken Demokratie bei. Gleichzeitig finden sich auch in zivilgesellschaftlichen Strukturen rechtsextreme, autoritäre und demokratiefeindliche Kräfte. In diesem Workshop schaut ihr genau hin: Wie unterscheiden sich autoritäre Einstellungen zwischen Engagierten und Nicht-Engagierten? In welchen Feldern sind Menschen mit (rechts-)autoritären Haltungen aktiv? Und welche soziodemografischen Faktoren spielen dabei eine Rolle?Gemeinsam diskutiert ihr, welche Rahmenbedingungen und Strategien notwendig sind, um zivilgesellschaftliches Engagement zu stärken und widerstandsfähig gegenüber autoritären Einflüssen zu machen.
„Digitale Resilienz braucht Vielfalt“
FLINTA* sind in der Nutzung von KI bisher unterrepräsentiert. Wie lässt sich künstliche Intelligenz gezielt und verantwortungsvoll eingesetzt werden – für mehr digitale Teilhabe?
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt – auch in der Zivilgesellschaft. Studien, die Männer und Frauen vergleichen, zeigen deutliche Unterschiede: Männer nutzen KI-Tools häufiger, schulen sich aktiver weiter und bringen sich stärker in strategische Diskussionen ein. Frauen dagegen äußern oftmals ethische Bedenken oder fühlen sich nicht ausreichend kompetent. Gerade im gemeinnützigen Sektor, in dem der Frauenanteil besonders hoch ist, droht so ein doppelter „Digital Gap” – zwischen Männern und Frauen sowie zwischen Profit- und Non-Profit-Sektor.Gleichzeitig ist klar: FLINTA* sind insgesamt in der Nutzung und Mitgestaltung dieser Technologien unterrepräsentiert. Genau hier setzt der Workshop an: Er richtet sich an FLINTA* aus gemeinnützigen Organisationen, die KI gezielt und verantwortungsvoll einsetzen wollen. Ziel ist es, dass ihr in eure digitale Selbstermächtigung stärkt und konkrete Wege kennenlernt, wie KI zur Professionalisierung und für eine nachhaltige Nutzung in der Zivilgesellschaft beitragen kann – durch strategische Impulse, Praxisbeispiele und kollegialen Austausch.
„Klick dich kritisch: Digitale Mündigkeit stärken“
Wie stärken wir Mündigkeit im Zeitalter der digitalen Transformation? Die „Digital Citizenship Education” liefert konkrete Ansätze.
Die digitale Welt verändert sich rasant, mit spürbaren Folgen für unsere Gesellschaft und Politik: Polarisierung, Filterblasen auf Social Media, zunehmende Radikalisierung oder der Einfluss häufiger KI-Nutzung auf das kritische Denken. Auch die politische Bildung ist gefragt, wenn es darum geht, auf diese Herausforderungen zu reagieren. Ein Ansatz dafür kommt vom Europarat: Digital Citizenship Education (DCE) fördert digitale Mündigkeit. In dieser Session lernt ihr das DCE-Handbuch mit seinen Kerninhalten kennen und bekommt konkrete Anregungen für eigenes Handeln in formalen wie non-formalen Bildungskontexten. In Kleingruppen arbeitet ihr mit Placemats – strukturierten Arbeitsvorlagen, die beim gemeinsamen Nachdenken, Diskutieren und Weiterentwickeln unterstützen.
„Wer gehört wird, entscheidet mit: Räume demokratischer gestalten“
Elena Kalogeropoulos fragt: Wie können digitale Räume so gestaltet werden, dass marginalisierte Stimmen sichtbar werden und demokratische Aushandlung möglich ist?
Polarisierung und digitale Logiken verändern unsere Diskurse. Plattformen schaffen Sichtbarkeit nach Klicks, nicht nach Relevanz – das schwächt demokratische Resilienz und verstärkt Ausschlüsse. Demokratische Kommunikation scheitert oft an ungleichen Voraussetzungen – wer spricht, wer gehört wird, ist selten neutral.Im Diskurs mit Elena Kalogeropoulos von EK & the good lab geht es um die strukturelle Unsichtbarkeit marginalisierter und kritischer Perspektiven in (algorithmisierten) Konflikträumen. Anhand konkreter Beispiele erfahrt ihr, wie „Accountable Spaces“ Schutz und verantwortungsvolle Aushandlung verbinden – als Gegenentwurf zu reiner Sichtbarkeitslogik. Gemeinsam diskutiert ihr, welche Formate Rechenschaft und Machtkritik stärken und was es braucht, damit digitaler Raum konstruktiven Diskurs ermöglicht.
„Co-Creating Our City: Jugendbeteiligung durch Citizen Science“
Lea Gronenberg und Tobias Spöri zeigen: Wie können Städte Jugendbeteiligung wirksam verankern – und welche Chancen bietet Citizen Science für lokale Demokratieprozesse?
Junge Menschen wollen bei Themen mitwirken, die sie direkt betreffen – stoßen dabei aber oft auf verschlossene Türen. Städte wiederum möchten jugendliche Perspektiven einbeziehen, wissen jedoch häufig nicht, wie. Genau hier setzt Co-Creating Our City an: Das Citizen-Science-Projekt bringt junge Menschen und Entscheidungsträger*innen zusammen, um Beteiligung vor Ort weiterzuentwickeln. Als Citizen Scientists erkunden Jugendliche ihre Lebenswelten, stärken demokratische Kompetenzen und entwickeln Handlungsempfehlungen. In Pilotprojekten in Deutschland und den USA entstand ein Toolkit, das inspiriert, Jugendbeteiligung neu zu denken. Im Diskurs mit Lea Gronenberg und Tobias Spöri reflektiert ihr, welche Learnings daraus entstehen und wie Citizen Science Jugendbeteiligung in anderen lokalen Kontexten stärken kann. Welche Voraussetzungen braucht es, damit sie langfristig und wirksam verankert wird?
„Politik neu denken: Kollaborative Ansätze verankern“
Pascal Müller-Scheiwiller denkt weiter: Wie können kollaborative Ansätze Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft verbinden – und dauerhaft in der Praxis verankert werden?
Politik und Verwaltung sind stark ausgelastet – es fehlt an Zeit, Methoden und oft auch an einer klaren Vision, wie große Ziele wie Netto-Null bis 2050 in konkrete Rahmenbedingungen übersetzt werden können. Gleichzeitig fällt es zivilgesellschaftlichen Akteur*innen und demokratischen Innovator*innen wie Bürger*innenräten schwer, an die etablierte Politik anzuknüpfen. Expedition Zukunft begegnet diesen Herausforderungen mit dem Space „Demokratie“: einem Raum, in dem neue Formate erprobt und Brücken zwischen Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gebaut werden.Im Diskurs mit Pascal Müller-Scheiwiller geht es um die Frage, wie Politik in ihrer Praxis neu gedacht werden kann. Welche kollaborativen Formate haben sich bereits bewährt? Welche brauchen neue Räume? Und wie lassen sie sich so verankern, dass sie dauerhaft Wirkung entfalten?
„Weiterentwicklung der Europäischen Bürger*innenjury“
Adela King fragt: Wie kann die Europäische Bürger*innenjury Beteiligung stärken, neue Formate entwickeln und Vertrauen in Demokratie und Institutionen zurückgewinnen?
Polarisierung, digitale Echokammern und schwindendes Vertrauen in Institutionen fordern die Demokratie heraus. Ein Gegenentwurf ist die Europäische Bürger*innenjury – ein Netzwerk engagierter Menschen, das jährlich entscheidet, welche Stadt zur Europäischen Demokratiehauptstadt wird. Damit setzt die Jury Impulse für Zusammenhalt, Frieden und europäische Werte. Jurymitglieder stärken in kostenlosen Trainings ihre Kompetenzen in Demokratiearbeit und Bürger*innenbeteiligung, während neue Beteiligungsformate wie Umfragen oder Crowdsourcing-Kampagnen erprobt werden.Im Diskurs mit Adela King von der European Capital of Democracy geht es darum, wie die Jury funktioniert, welchen Mehrwert sie für die europäische Demokratie schafft und wie sie weiterentwickelt werden kann. Gemeinsam diskutiert ihr: Welche Hindernisse erschweren die Beteiligung? Welche Potenziale sind noch ungenutzt? Und welche Anreize braucht es, damit Bürger*innenjurys dauerhaft attraktiv bleiben?
„Resilient durch Rollenwechsel“
Ein Planspiel zeigt, wie öffentliche Institutionen antidemokratischem Druck begegnen können – mit konkreten Schritten und Impulsen für die eigene Praxis.
Demokratie stärken? Klingt gut – aber wie konkret? In einem Planspiel erlebten Bibliotheks-Führungskräfte, wie sich antidemokratischer Druck anfühlt – und wie sie in herausfordernden Situationen reagieren. Die Erfahrung hat gezeigt, welche Handlungsspielräume bereits da sind und was es braucht, um in Zukunft besser aufgestellt zu sein. Spoiler: Das Spiel hat gewirkt. Aus dem Planspiel entwickelten sich konkrete Schritte – intern wie extern. Dazu zählen Investitionen in die Deeskalationskompetenz der Mitarbeitenden über ein gemeinsames Verständnis von Demokratiestärkung im Verbund – mit klaren Werten und Handlungsfeldern, bis hin zur aktiven Beteiligung an Aktionstagen.
Am Beispiel der Berliner Bibliotheken zeigt sich, wie öffentliche Institutionen auch unter Druck handlungsfähig bleiben – und welche Impulse auch für andere hilfreich sein können. Diese lassen sich schließlich in einen Mini-Fahrplan für die eigene Praxis übersetzen.
„Ting – ein Fonds für Demokratie“
Ting ist eine digitale Community, die Geld teilt. Ein gemeinsamer Fonds fördert gesellschaftlich sinnhafte Vorhaben und ermöglicht so demokratisches Handeln.
Wer sich gesellschaftlich einbringen will, braucht nicht nur Mut und Ideen, sondern auch Zeit, Spielraum und Sicherheit. Wie kann gemeinschaftlich geteiltes Geld, demokratisches Handeln ermöglichen? Genau hier setzt Ting an: Die Online-Community zahlt monatlich freiwillige Beiträge in einen solidarischen Fonds ein. Dieses Vermögen wird an diejenigen Mitglieder verteilt, die sich im Sinne der SDGs (Sustainable Development Goals) für soziale, ökologische oder gesellschaftliche Anliegen engagieren.
Ting ist mehr als ein Umverteilungsinstrument. Es wirkt als zivilgesellschaftlicher Katalysator, der Beteiligung erleichtert und kollektives Handeln fördert. Die Community entscheidet gemeinsam, welche Vorhaben unterstützt, werden: demokratisch, transparent, unbürokratisch. In 75 Minuten erfahrt ihr, wie das Modell funktioniert, welche Erfahrungen Ting damit gemacht hat – und welche beispielhaften Vorhaben bereits gefördert wurden.
„Verliebt, Verlobt, Vernetzt“
Das Projekt „toneshift – Netzwerk gegen Hass und Desinformation” zeigt, wie wirkungsvolle Zusammenarbeit gelingt und welche Strategien dabei unterstützen.
Kollaborationen und Zusammenarbeit stärken die Zivilgesellschaft – doch im Alltag scheitern sie oft an unterschiedlichen Organisationskulturen, Arbeitsweisen und inhaltlichen Schwerpunkten. Diese Hürden bremsen gemeinsames Handeln und schwächen die Wirkung nach außen. In diesem Beitrag erlebt ihr, wie wirkungsvolle, interdisziplinäre Zusammenarbeit aussehen kann. In einer Simulation durchlauft ihr einen Governance-Prozess, der Dynamiken und Herausforderungen in der Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteur*innen sichtbar macht. Gemeinsam entwickelt ihr konstruktive Lösungsansätze. Zum Abschluss teilt „toneshift – Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation“ zentrale Erkenntnisse aus der Praxis.
„Kunst und Kultur (fair)ändern“
Wie fördern Kulturorganisationen eine „Culture of Belonging“ für Mitarbeitende und Publikum? Aus Internationale Ansätzen entstehen gemeinsame Strategien.
Unsere Gesellschaft erlebt einen kulturellen Bruch: Demokratie, Vielfalt und empathisches Miteinander sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch Kunst und Kultur entstehen oft in prekären, unfairen Arbeitsumfeldern. Während es viele theoretische Ansätze für mehr Gerechtigkeit gibt, schaffen es diese selten in die institutionelle Praxis – oder werden in unterfinanzierten Abteilungen für Kulturvermittlung ausgelagert.
In diesem Beitrag nehmt ihr Fairness selbst in die Hand. Nach einem Check-in sammelt ihr Inputs und wählt gemeinsam ein Visualisierungsmodell für einen prototypischen „Fairnessprozesses“ aus. Im World-Café-Format erarbeitet ihr strategische Ziele, bevor ihr den Prozess in einem gemeinsamen Abschluss reflektiert. Der visualisierte Fairnessprozess zeigt, wie Themen wie Prävention von Machtmissbrauch, mentale Gesundheit und Resilienz zu festen Bestandteilen institutioneller Praxis werden können – und was Fairness in Kunst und Kultur bedeuten kann.
„Eine Frage von Mehrheiten“
Wer Veränderung will, braucht demokratische Mehrheiten – nicht nur gute Ideen. Was braucht es damit Wandel gelingt? Und wen braucht es, um den Status quo zu verändern?
Ob Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit oder Menschenrechte – Engagement bringt Menschen zusammen und Bewegung in Gange. Doch dann die politische Ernüchterung: Wahlen gehen in andere Richtungen, politischer Versprechen bleiben leer und Veränderung stockt. Und plötzlich steht die Frage im Raum: Wie zukunftsfähig ist unsere Demokratie noch? Doch Demokratie ist kein Umsetzungsgarant, sondern ein Versprechen, Lösungen gemeinsam auszuhandeln. Der Glaube, im Recht zu sein, reicht nicht aus – es braucht Mehrheiten. Und genau hier setzt dieser Workshop an: Wie gelingt gesellschaftlicher Wandel unter demokratischen Bedingungen? Was braucht es, damit gute Ideen politisch tragfähig werden? Im Zentrum steht die Frage, wie ihr Allianzen jenseits eurer eigenen Milieus aufbauen könnt. Auf Basis des Transformative-Change-Making-Ansatzes nehmt ihr eine strategische Perspektive ein, die hilft zu erkennen: Was und wen braucht es wirklich, um den Status quo zu verändern? Und wie gelingt es, bislang distanzierte Akteur*innen für eure Anliegen zu gewinnen?
„Digitale und analoge Beteiligung neu zusammendenken“
Alina Schütze spricht über hybride Formate, die Menschen niedrigschwellig einbinden und demokratische Teilhabe inklusiver machen.
Viele Menschen beteiligen sich kaum an politischen Prozessen – mit spürbaren Folgen für die demokratische Kultur. Beteiligung gelingt, wenn Formate niederschwellig sind, unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen und ko-kreativ Lösungen entwickeln. Dafür braucht es Räume – digital wie analog. Im Diskurs mit Alina Schütze von Make.org geht es um das Zusammenspiel digitaler und analoger Beteiligung. Anhand konkreter Projektbeispiele diskutiert ihr: Welche digitalen Tools eignen sich dafür besonders? Wie können Beteiligungsformate Menschen einbeziehen, deren Stimmen bislang zu selten gehört wurden?
„Postmigrantische Gesellschaften transalpin denken“
Hannan Salamat uns Sunčana Laketa sprechen über die Verankerung postmigrantischer Realitäten in Institutionen und neue Räume für Zugehörigkeit.
Postmigrantische Realitäten sind längst gesellschaftliche Normalität – trotzdem sind sie in Institutionen oft kaum verankert. Gleichzeitig fehlen Ressourcen, und progressive Kämpfe bleiben häufig zersplittert. Im Diskurs mit Hannan Salamat und Sunčana Laketa von dem Institut Neue Schweiz geht es darum, wie diese Spannungen solidarisch, transnational und zukunftsorientiert bearbeitet werden können. Hannan bringt dabei Erfahrungen aus kuratorischer und konzeptioneller Arbeit ein – etwa vom Transalpinen Festival zwischen Wien, Zürich und München oder vom ZIID Zürich, wo sie Formate zu Pluralität, Erinnerungskultur und demokratischer Teilhabe entwickelt. Sunčana ergänzt die Perspektive aus der Geschäftsstelle von INES: Wie lassen sich postmigrantische Perspektiven in Strukturen verankern, und wie können Ressourcen gebündelt werden, damit progressive Kämpfe gemeinsame wirken?Ihr diskutiert, welche Strategien, Allianzen und Narrative notwendig sind, um neue Handlungsspielräume für eine plurale, gerechte und solidarische Gesellschaft sichtbar zu machen.
„Mit Create your City zur aktiven Mitgestaltung“
Lena Maria Bichler thematisiert: Wie können junge Menschen frühzeitig für Partizipation begeistert werden – und wie zeigt „Create your City“, dass Mitgestaltung konkret möglich ist?
Seit 2019 können Linzer*innen am Innovationshauptplatz eigene Ideen für die Stadt einbringen – doch viele wissen das nicht. Der Partizipations-Workshop „Create your City“ soll vor allem junge Menschen motivieren, ihr Umfeld mitzugestalten. Dabei geht es nicht nur ums Einreichen von Vorschlägen, sondern um Debatte, Haltung und die Erfahrung, dass Mitreden Wirkung zeigt.Im Diskurs mit Lena Maria Bichler vom Innovationshauptplatz der Stadt Linz sprecht ihr über Erfahrungen aus der Praxis: Wie kann Jugendbeteiligung so gestaltet werden, dass junge Stimmen frühzeitig Gehör finden? Welche Herausforderungen gilt es dabei zu überwinden – und wie können Formate weiterentwickelt werden, um auch andere Zielgruppen einzubeziehen?
„Lab: Beteiligung und Demokratie“
Wir bündeln Erfahrungen, um Beteiligung neu zu denken und Wege zu finden, wie sie Menschen wieder stärker verbindet.
Demokratie lebt davon, dass Menschen sich beteiligen und mitgestalten – doch vielerorts gelingt das immer weniger. Viele fühlen sich von politischen Prozessen ausgeschlossen oder werden nicht gehört. Gleichzeitig suchen Kommunen und Institutionen nach neuen Wegen, um den Dialog mit Bürger*innen zu stärken. Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten bringen wir bestehende Formate und Erfahrungen aus dem DACH-Raum zusammen, um sie zu bündeln, Synergien sichtbar zu machen und daraus gemeinsame Zukunftsbilder abzuleiten. Das Lab wird vom Schweizer Dachverband Partizipation gehostet, der sich für Qualität, Wirksamkeit und eine Kultur der Mitgestaltung in Partizipationsprozessen einsetzt. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Digitale Öffentlichkeit und Demokratie“
In diesem Lab gestalten wir Zukunftsbilder für eine digitale Öffentlichkeit, die Hass und Desinformation wirksam entgegentritt und Zusammenhalt stärkt.
Hassrede und Desinformation untergraben Vertrauen, spalten Gesellschaften und gefährden die Grundlagen demokratischer Verständigung. Im Lab Digitale Öffentlichkeit & Demokratie beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Interventionen es gegen diese Dynamiken bereits gibt – und welche neuen Strategien es braucht, um digitale Räume zu stärken. Ausgangspunkt sind bestehende Ansätze beispielsweise aus Prävention und Bildung, Regulierung, Kommunikation, Nachsorge und Analyse. Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten sichten wir, was vorhanden ist und wo noch Lücken bestehen. Das Lab wird von das NETTZ, der Vernetzungsstelle gegen Hass im Netz, gehostet, das Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik verbindet. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Alltagsorte und Demokratie“
In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Alltagsorte Begegnung, Zugehörigkeit und Vertrauen in die demokratische Gesellschaft stärken.
Demokratie wird nicht nur in Parlamenten erfahrbar, sondern überall dort gelebt und verhandelt, wo Menschen sich im Alltag begegnen: im Verein, beim Einkaufen, in der Bar oder auf dem Spielplatz. Diese Orte prägen, wie wir unsere Mitmenschen und auch Demokratie erleben. Doch heute schwinden viele dieser Orte, Begegnungen werden seltener und Menschen empfinden öffentliche Räume als unsicher. Welche Orte braucht es und wie können wir sie so gestalten, dass sie gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern? In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Alltagsorte Begegnung, Zugehörigkeit und Zutrauen in die demokratische Handlungsfähigkeit und gesellschaftliche Zukunftsgestaltung stärken. Das Lab wird von More in Common gehostet, einer Organisation, die erforscht, was Gesellschaften zusammenhält und wie Vertrauen und Zugehörigkeit demokratischen Gesellschaften gestärkt werden können. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Emotionen & Demokratie“
In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Emotionen als demokratische Kraft wirken – und wir so autoritären Tendenzen wirkungsvoll entgegentreten.
Autoritarismus überzeugt nicht mit Argumenten und Programmen, sondern agiert tiefer. Er kreiert mächtige kollektive Affekte und kanalisiert (un)bewusste Wünsche und Ängste. Demokratien reagieren darauf oft rational – mit Programm, Struktur und Appell. Doch ohne ein Verständnis der tief liegenden Affektdynamiken bleibt ihre Wirkung begrenzt. Unter welchen Bedingungen sind eine lebenswerte Zukunft und demokratische Ideale wieder vorstellbar? Fachexpert*innen und Interessierte erkunden gemeinsam, welche Rolle Emotionen in der Politik spielen und entwickeln strategische Ansatzpunkte, wie dieses Wissen gezielt in demokratische Bildungs-, Kommunikations- und Beteiligungsprozesse einfließen kann. Das Lab wird von Beyond Molotovs gehostet, einem Kollektiv, das sich seit 2020 mit anti-autoritären Gegenstrategien beschäftigt. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Kollektives Wirken und Demokratie"
In diesem Lab entstehen Zukunftsbilder, in denen Ressourcen, Wissen und Strategien gebündelt werden, um die Demokratie nachhaltig zu stärken.
Demokratische Strukturen stehen unter Druck, während gesellschaftliche Herausforderungen immer komplexer werden. Fragmentierung, Konkurrenzdenken und fehlende Abstimmung verhindern, dass Initiativen ihr volles Potenzial entfalten. Um die Demokratie zukunftsfähig zu halten, braucht es neue Formen der Zusammenarbeit über Sektorgrenzen hinweg. Wie können gemeinsame Strategien entstehen und kollektive Wirkung entfaltet? Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Kräfte gebündelt, Verantwortung geteilt und Allianzen geschaffen werden, um Veränderungen langfristig zu verankern. Das Lab wird von Phineo und Ashoka Austria gehostet – zwei Organisationen, die soziale Innovation, Wirkungsmessung und sektorübergreifende Zusammenarbeit fördern, um gemeinsames Handeln für die Demokratie zu stärken. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Wir feiern Mitmacht und Mitwirkung“
Der Abschluss des Mitmacht Festivals und die Demokratiehaupstadt Wien 2024/25 steht bevor!
Am 21. November laden das Büro für Mitwirkung der Stadt Wien und Faktor D herzlich zur großen Abschlussparty des Mitmacht Festivals 2025 und der Europäischen Demokratiehauptstadt 2024/25 ein! Gemeinsam wollen wir feiern, zurückblicken und nach vorne schauen. Dich erwartet eine musikalische Performance von Teilnehmenden des Jugendprojekts „Demokratie, was geht?“. In ihren Texten spiegeln sich persönliche Erfahrungen, gesellschaftliche Fragen und politische Themen. Die Performance ist ein kraftvolles Statement, in dem marginalisierte Perspektiven Gehör finden. Bei Musik und Drinks gibt es die Gelegenheit, Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zu treffen, die sich für Demokratie, Teilhabe und Mitgestaltung einsetzen und interessieren.
„Kunst im Kollektiv“
Mitmacht 2025 bringt künstlerische Projekte zusammen, die Begegnungen ermöglichen und gesellschaftliche Missstände sichtbar machen.
Demokratie ist vielseitig erfahrbar. Über das ganze Mitmacht-Festival lang, wirken tolle Partner*innen und Projekte, unterschiedlich am Programm mit:
„listen&share“ ist eine begehbare Installation, die dazu einlädt, Fragen, Erfahrungen und Perspektiven gemeinsam zu erkunden. Besucher*innen hören einander zu, teilen Gedanken und gestalten so ein kollektives Bild dessen, was uns bewegt. (Gestaltet von Astrid Kirchhoff, Birger Strahl & Tobias Zucali)
Das Projekt Design Democracy setzt sich mit digitalen Postern für mehr Demokratie und Respekt im Netz ein. Gestalter*innen werden dazu aufgerufen, ihre Kunst in Form von Postern zu spenden. Design Democracy verbreitet diese Poster als visuelle Counterspeech auf Social Media, um damit einen Gegenpol zu diskriminierenden und extremistischen Inhalten zu bilden. (Gestaltet von Ravena Hengst)
Das Projekt „Demokratie, was geht?“ gibt jungen, marginalisierten Menschen Raum, ihre Gefühle und Visionen hör- und sichtbar zu machen. Bei Mitmacht gestalten Teilnehmende zwei Programmpunkte: Mit „Poetic Recording“ wird das Festival in Klang und Wort zu einer Performance verdichtet. Stimmen, Bilder, Geschichten und Stimmungen der Teilnehmenden verschmelzen zu einer lebendigen Poesie, die den Abend nachklingen lässt. (Gestaltet von Jonas Scheiner)
Die Lichtinstallation „Enlightening Stories“ zeigt auf kleinen Tafeln 3D-gedruckte Reliefbilder der Teilnehmenden. Unsichtbare Laserstrahlen tragen codierte Tonspuren – Geschichten der Jugendlichen, hörbar für alle, die aktiv zuhören. Wie auch in der Gesellschaft braucht es oft erst den bewussten Blick, um die Geschichten derer zu entdecken, die an den Rand gedrängt wurden. Hier stehen sie im Zentrum. (Gestaltet von Çağdaş Çeçen)
„Soziale Stadtführung“
Obdachlosigkeit hat viele Gesichter. Die „Backstreet–Guides“ zeigen Wien aus der Sicht Betroffener und erzählen persönliche Geschichten.
Obdachlosigkeit wird in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals bloß mit dem alkoholisierten, ungepflegten Mann gleichgesetzt. Vorgefasste Meinungen und Stereotypen verdrängen die aktive Auseinandersetzung und das "Hinschauen" auf den Menschen und das Schicksal, das zur Obdachlosigkeit führte. Der „Verein Backstreet – Guides Grätzl Touren“ organisiert Führungen durch unterschiedliche Stadtteile mit Fokus auf das Thema Obdachlosigkeit. Sie erzählen über die Probleme für ökonomisch nicht leistungsfähige Personen und verbinden dies mit ihren eigenen Schicksalen und Orten. Gerade diese Nähe zum eigenen Viertel trägt zur Authentizität wesentlich bei. Hedy verfügt als ehemalige Bezirkspolitikerin und Betroffene über ausreichend Erfahrung und freut sich, ihre Erfahrungen mit euch zu teilen.
„Sketchen MACHT Sinn – ran an die Stifte!“
Dieser Mini-Workshop soll Mut zum Zeichnen machen. Damit wir die Kraft von Bildern gemeinsam nutzen und unsere Visionen klar aufs Papier bringen können.
Ob du Meetings zusammenfasst, eine Gruppe moderierst oder dein Wissen in Workshops weitergibst: Bilder helfen. Sie verankern Ideen, unterstützen beim Lernen. Sie wecken Emotionen und können Brücken bauen. Ihr experimentiert mit einfachen Symbolen, bekommt Tipps zu schöner Handschrift und lernt den Aufbau einer strukturierten Seite. Ganz entspannt – kein Kunstprojekt, sondern ein Werkzeug für klare Kommunikation. Wie eine einfache Mitschrift, nur spannender. Denn die eigentliche Kunst liegt darin, das Wesentliche übersichtlich aufs Blatt zu bringen – als Wohltat für die Leser*innen und Boost für die Botschaft. Bitte mitbringen: Notizheft oder Block (A5 oder A4-Format), Fineliner oder ähnliches, in Schwarz und 1-2 weiteren Farben. Aber kein Stress: Kugelschreiber und Leuchtmarker tun’s fürs Erste auch. Einfach mal machen.
„Sketchen MACHT Sinn – ran an die Stifte!“
Dieser Mini-Workshop soll Mut zum Zeichnen machen. Damit wir die Kraft von Bildern gemeinsam nutzen und unsere Visionen klar aufs Papier bringen können.
Ob du Meetings zusammenfasst, eine Gruppe moderierst oder dein Wissen in Workshops weitergibst: Bilder helfen. Sie verankern Ideen, unterstützen beim Lernen. Sie wecken Emotionen und können Brücken bauen. Ihr experimentiert mit einfachen Symbolen, bekommt Tipps zu schöner Handschrift und lernt den Aufbau einer strukturierten Seite. Ganz entspannt – kein Kunstprojekt, sondern ein Werkzeug für klare Kommunikation. Wie eine einfache Mitschrift, nur spannender. Denn die eigentliche Kunst liegt darin, das Wesentliche übersichtlich aufs Blatt zu bringen – als Wohltat für die Leser*innen und Boost für die Botschaft. Bitte mitbringen: Notizheft oder Block (A5 oder A4-Format), Fineliner oder ähnliches, in Schwarz und 1-2 weiteren Farben. Aber kein Stress: Kugelschreiber und Leuchtmarker tun’s fürs Erste auch. Einfach mal machen.
„Soziale Stadtführung“
Obdachlosigkeit hat viele Gesichter. Die „Backstreet–Guides“ zeigen Wien aus der Sicht Betroffener und erzählen persönliche Geschichten.
Obdachlosigkeit wird in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals bloß mit dem alkoholisierten, ungepflegten Mann gleichgesetzt. Vorgefasste Meinungen und Stereotypen verdrängen die aktive Auseinandersetzung und das "Hinschauen" auf den Menschen und das Schicksal, das zur Obdachlosigkeit führte. Der „Verein Backstreet – Guides Grätzl Touren“ organisiert Führungen durch unterschiedliche Stadtteile mit Fokus auf das Thema Obdachlosigkeit. Sie erzählen über die Probleme für ökonomisch nicht leistungsfähige Personen und verbinden dies mit ihren eigenen Schicksalen und Orten. Gerade diese Nähe zum eigenen Viertel trägt zur Authentizität wesentlich bei. Hedy verfügt als ehemalige Bezirkspolitikerin und Betroffene über ausreichend Erfahrung und freut sich, ihre Erfahrungen mit euch zu teilen.
„Kunst im Kollektiv“
Mitmacht 2025 bringt künstlerische Projekte zusammen, die Begegnungen ermöglichen und gesellschaftliche Missstände sichtbar machen.
Demokratie ist vielseitig erfahrbar. Über das ganze Mitmacht-Festival lang, wirken tolle Partner*innen und Projekte, unterschiedlich am Programm mit:
„listen&share“ ist eine begehbare Installation, die dazu einlädt, Fragen, Erfahrungen und Perspektiven gemeinsam zu erkunden. Besucher*innen hören einander zu, teilen Gedanken und gestalten so ein kollektives Bild dessen, was uns bewegt. (Gestaltet von Astrid Kirchhoff, Birger Strahl & Tobias Zucali)
Das Projekt Design Democracy setzt sich mit digitalen Postern für mehr Demokratie und Respekt im Netz ein. Gestalter*innen werden dazu aufgerufen, ihre Kunst in Form von Postern zu spenden. Design Democracy verbreitet diese Poster als visuelle Counterspeech auf Social Media, um damit einen Gegenpol zu diskriminierenden und extremistischen Inhalten zu bilden. (Gestaltet von Ravena Hengst)
Das Projekt „Demokratie, was geht?“ gibt jungen, marginalisierten Menschen Raum, ihre Gefühle und Visionen hör- und sichtbar zu machen. Bei Mitmacht gestalten Teilnehmende zwei Programmpunkte: Mit „Poetic Recording“ wird das Festival in Klang und Wort zu einer Performance verdichtet. Stimmen, Bilder, Geschichten und Stimmungen der Teilnehmenden verschmelzen zu einer lebendigen Poesie, die den Abend nachklingen lässt. (Gestaltet von Jonas Scheiner)
Die Lichtinstallation „Enlightening Stories“ zeigt auf kleinen Tafeln 3D-gedruckte Reliefbilder der Teilnehmenden. Unsichtbare Laserstrahlen tragen codierte Tonspuren – Geschichten der Jugendlichen, hörbar für alle, die aktiv zuhören. Wie auch in der Gesellschaft braucht es oft erst den bewussten Blick, um die Geschichten derer zu entdecken, die an den Rand gedrängt wurden. Hier stehen sie im Zentrum. (Gestaltet von Çağdaş Çeçen)
„Wir feiern Mitmacht und Mitwirkung“
Der Abschluss des Mitmacht Festivals und die Demokratiehaupstadt Wien 2024/25 steht bevor!
Am 21. November laden das Büro für Mitwirkung der Stadt Wien und Faktor D herzlich zur großen Abschlussparty des Mitmacht Festivals 2025 und der Europäischen Demokratiehauptstadt 2024/25 ein! Gemeinsam wollen wir feiern, zurückblicken und nach vorne schauen. Dich erwartet eine musikalische Performance von Teilnehmenden des Jugendprojekts „Demokratie, was geht?“. In ihren Texten spiegeln sich persönliche Erfahrungen, gesellschaftliche Fragen und politische Themen. Die Performance ist ein kraftvolles Statement, in dem marginalisierte Perspektiven Gehör finden. Bei Musik und Drinks gibt es die Gelegenheit, Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zu treffen, die sich für Demokratie, Teilhabe und Mitgestaltung einsetzen und interessieren.
„Lab: Kollektives Wirken und Demokratie"
In diesem Lab entstehen Zukunftsbilder, in denen Ressourcen, Wissen und Strategien gebündelt werden, um die Demokratie nachhaltig zu stärken.
Demokratische Strukturen stehen unter Druck, während gesellschaftliche Herausforderungen immer komplexer werden. Fragmentierung, Konkurrenzdenken und fehlende Abstimmung verhindern, dass Initiativen ihr volles Potenzial entfalten. Um die Demokratie zukunftsfähig zu halten, braucht es neue Formen der Zusammenarbeit über Sektorgrenzen hinweg. Wie können gemeinsame Strategien entstehen und kollektive Wirkung entfaltet? Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Kräfte gebündelt, Verantwortung geteilt und Allianzen geschaffen werden, um Veränderungen langfristig zu verankern. Das Lab wird von Phineo und Ashoka Austria gehostet – zwei Organisationen, die soziale Innovation, Wirkungsmessung und sektorübergreifende Zusammenarbeit fördern, um gemeinsames Handeln für die Demokratie zu stärken. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Emotionen & Demokratie“
In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Emotionen als demokratische Kraft wirken – und wir so autoritären Tendenzen wirkungsvoll entgegentreten.
Autoritarismus überzeugt nicht mit Argumenten und Programmen, sondern agiert tiefer. Er kreiert mächtige kollektive Affekte und kanalisiert (un)bewusste Wünsche und Ängste. Demokratien reagieren darauf oft rational – mit Programm, Struktur und Appell. Doch ohne ein Verständnis der tief liegenden Affektdynamiken bleibt ihre Wirkung begrenzt. Unter welchen Bedingungen sind eine lebenswerte Zukunft und demokratische Ideale wieder vorstellbar? Fachexpert*innen und Interessierte erkunden gemeinsam, welche Rolle Emotionen in der Politik spielen und entwickeln strategische Ansatzpunkte, wie dieses Wissen gezielt in demokratische Bildungs-, Kommunikations- und Beteiligungsprozesse einfließen kann. Das Lab wird von Beyond Molotovs gehostet, einem Kollektiv, das sich seit 2020 mit anti-autoritären Gegenstrategien beschäftigt. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Alltagsorte und Demokratie“
In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Alltagsorte Begegnung, Zugehörigkeit und Vertrauen in die demokratische Gesellschaft stärken.
Demokratie wird nicht nur in Parlamenten erfahrbar, sondern überall dort gelebt und verhandelt, wo Menschen sich im Alltag begegnen: im Verein, beim Einkaufen, in der Bar oder auf dem Spielplatz. Diese Orte prägen, wie wir unsere Mitmenschen und auch Demokratie erleben. Doch heute schwinden viele dieser Orte, Begegnungen werden seltener und Menschen empfinden öffentliche Räume als unsicher. Welche Orte braucht es und wie können wir sie so gestalten, dass sie gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern? In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Alltagsorte Begegnung, Zugehörigkeit und Zutrauen in die demokratische Handlungsfähigkeit und gesellschaftliche Zukunftsgestaltung stärken. Das Lab wird von More in Common gehostet, einer Organisation, die erforscht, was Gesellschaften zusammenhält und wie Vertrauen und Zugehörigkeit demokratischen Gesellschaften gestärkt werden können. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Digitale Öffentlichkeit und Demokratie“
In diesem Lab gestalten wir Zukunftsbilder für eine digitale Öffentlichkeit, die Hass und Desinformation wirksam entgegentritt und Zusammenhalt stärkt.
Hassrede und Desinformation untergraben Vertrauen, spalten Gesellschaften und gefährden die Grundlagen demokratischer Verständigung. Im Lab Digitale Öffentlichkeit & Demokratie beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Interventionen es gegen diese Dynamiken bereits gibt – und welche neuen Strategien es braucht, um digitale Räume zu stärken. Ausgangspunkt sind bestehende Ansätze beispielsweise aus Prävention und Bildung, Regulierung, Kommunikation, Nachsorge und Analyse. Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten sichten wir, was vorhanden ist und wo noch Lücken bestehen. Das Lab wird von das NETTZ, der Vernetzungsstelle gegen Hass im Netz, gehostet, das Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik verbindet. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Beteiligung und Demokratie“
Wir bündeln Erfahrungen, um Beteiligung neu zu denken und Wege zu finden, wie sie Menschen wieder stärker verbindet.
Demokratie lebt davon, dass Menschen sich beteiligen und mitgestalten – doch vielerorts gelingt das immer weniger. Viele fühlen sich von politischen Prozessen ausgeschlossen oder werden nicht gehört. Gleichzeitig suchen Kommunen und Institutionen nach neuen Wegen, um den Dialog mit Bürger*innen zu stärken. Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten bringen wir bestehende Formate und Erfahrungen aus dem DACH-Raum zusammen, um sie zu bündeln, Synergien sichtbar zu machen und daraus gemeinsame Zukunftsbilder abzuleiten. Das Lab wird vom Schweizer Dachverband Partizipation gehostet, der sich für Qualität, Wirksamkeit und eine Kultur der Mitgestaltung in Partizipationsprozessen einsetzt. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Mit Create your City zur aktiven Mitgestaltung“
Lena Maria Bichler thematisiert: Wie können junge Menschen frühzeitig für Partizipation begeistert werden – und wie zeigt „Create your City“, dass Mitgestaltung konkret möglich ist?
Seit 2019 können Linzer*innen am Innovationshauptplatz eigene Ideen für die Stadt einbringen – doch viele wissen das nicht. Der Partizipations-Workshop „Create your City“ soll vor allem junge Menschen motivieren, ihr Umfeld mitzugestalten. Dabei geht es nicht nur ums Einreichen von Vorschlägen, sondern um Debatte, Haltung und die Erfahrung, dass Mitreden Wirkung zeigt.Im Diskurs mit Lena Maria Bichler vom Innovationshauptplatz der Stadt Linz sprecht ihr über Erfahrungen aus der Praxis: Wie kann Jugendbeteiligung so gestaltet werden, dass junge Stimmen frühzeitig Gehör finden? Welche Herausforderungen gilt es dabei zu überwinden – und wie können Formate weiterentwickelt werden, um auch andere Zielgruppen einzubeziehen?
„Postmigrantische Gesellschaften transalpin denken“
Hannan Salamat uns Sunčana Laketa sprechen über die Verankerung postmigrantischer Realitäten in Institutionen und neue Räume für Zugehörigkeit.
Postmigrantische Realitäten sind längst gesellschaftliche Normalität – trotzdem sind sie in Institutionen oft kaum verankert. Gleichzeitig fehlen Ressourcen, und progressive Kämpfe bleiben häufig zersplittert. Im Diskurs mit Hannan Salamat und Sunčana Laketa von dem Institut Neue Schweiz geht es darum, wie diese Spannungen solidarisch, transnational und zukunftsorientiert bearbeitet werden können. Hannan bringt dabei Erfahrungen aus kuratorischer und konzeptioneller Arbeit ein – etwa vom Transalpinen Festival zwischen Wien, Zürich und München oder vom ZIID Zürich, wo sie Formate zu Pluralität, Erinnerungskultur und demokratischer Teilhabe entwickelt. Sunčana ergänzt die Perspektive aus der Geschäftsstelle von INES: Wie lassen sich postmigrantische Perspektiven in Strukturen verankern, und wie können Ressourcen gebündelt werden, damit progressive Kämpfe gemeinsame wirken?Ihr diskutiert, welche Strategien, Allianzen und Narrative notwendig sind, um neue Handlungsspielräume für eine plurale, gerechte und solidarische Gesellschaft sichtbar zu machen.
„Digitale und analoge Beteiligung neu zusammendenken“
Alina Schütze spricht über hybride Formate, die Menschen niedrigschwellig einbinden und demokratische Teilhabe inklusiver machen.
Viele Menschen beteiligen sich kaum an politischen Prozessen – mit spürbaren Folgen für die demokratische Kultur. Beteiligung gelingt, wenn Formate niederschwellig sind, unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen und ko-kreativ Lösungen entwickeln. Dafür braucht es Räume – digital wie analog. Im Diskurs mit Alina Schütze von Make.org geht es um das Zusammenspiel digitaler und analoger Beteiligung. Anhand konkreter Projektbeispiele diskutiert ihr: Welche digitalen Tools eignen sich dafür besonders? Wie können Beteiligungsformate Menschen einbeziehen, deren Stimmen bislang zu selten gehört wurden?
„Eine Frage von Mehrheiten“
Wer Veränderung will, braucht demokratische Mehrheiten – nicht nur gute Ideen. Was braucht es damit Wandel gelingt? Und wen braucht es, um den Status quo zu verändern?
Ob Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit oder Menschenrechte – Engagement bringt Menschen zusammen und Bewegung in Gange. Doch dann die politische Ernüchterung: Wahlen gehen in andere Richtungen, politischer Versprechen bleiben leer und Veränderung stockt. Und plötzlich steht die Frage im Raum: Wie zukunftsfähig ist unsere Demokratie noch? Doch Demokratie ist kein Umsetzungsgarant, sondern ein Versprechen, Lösungen gemeinsam auszuhandeln. Der Glaube, im Recht zu sein, reicht nicht aus – es braucht Mehrheiten. Und genau hier setzt dieser Workshop an: Wie gelingt gesellschaftlicher Wandel unter demokratischen Bedingungen? Was braucht es, damit gute Ideen politisch tragfähig werden? Im Zentrum steht die Frage, wie ihr Allianzen jenseits eurer eigenen Milieus aufbauen könnt. Auf Basis des Transformative-Change-Making-Ansatzes nehmt ihr eine strategische Perspektive ein, die hilft zu erkennen: Was und wen braucht es wirklich, um den Status quo zu verändern? Und wie gelingt es, bislang distanzierte Akteur*innen für eure Anliegen zu gewinnen?
„Kunst und Kultur (fair)ändern“
Wie fördern Kulturorganisationen eine „Culture of Belonging“ für Mitarbeitende und Publikum? Aus Internationale Ansätzen entstehen gemeinsame Strategien.
Unsere Gesellschaft erlebt einen kulturellen Bruch: Demokratie, Vielfalt und empathisches Miteinander sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch Kunst und Kultur entstehen oft in prekären, unfairen Arbeitsumfeldern. Während es viele theoretische Ansätze für mehr Gerechtigkeit gibt, schaffen es diese selten in die institutionelle Praxis – oder werden in unterfinanzierten Abteilungen für Kulturvermittlung ausgelagert.
In diesem Beitrag nehmt ihr Fairness selbst in die Hand. Nach einem Check-in sammelt ihr Inputs und wählt gemeinsam ein Visualisierungsmodell für einen prototypischen „Fairnessprozesses“ aus. Im World-Café-Format erarbeitet ihr strategische Ziele, bevor ihr den Prozess in einem gemeinsamen Abschluss reflektiert. Der visualisierte Fairnessprozess zeigt, wie Themen wie Prävention von Machtmissbrauch, mentale Gesundheit und Resilienz zu festen Bestandteilen institutioneller Praxis werden können – und was Fairness in Kunst und Kultur bedeuten kann.
„Verliebt, Verlobt, Vernetzt“
Das Projekt „toneshift – Netzwerk gegen Hass und Desinformation” zeigt, wie wirkungsvolle Zusammenarbeit gelingt und welche Strategien dabei unterstützen.
Kollaborationen und Zusammenarbeit stärken die Zivilgesellschaft – doch im Alltag scheitern sie oft an unterschiedlichen Organisationskulturen, Arbeitsweisen und inhaltlichen Schwerpunkten. Diese Hürden bremsen gemeinsames Handeln und schwächen die Wirkung nach außen. In diesem Beitrag erlebt ihr, wie wirkungsvolle, interdisziplinäre Zusammenarbeit aussehen kann. In einer Simulation durchlauft ihr einen Governance-Prozess, der Dynamiken und Herausforderungen in der Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteur*innen sichtbar macht. Gemeinsam entwickelt ihr konstruktive Lösungsansätze. Zum Abschluss teilt „toneshift – Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation“ zentrale Erkenntnisse aus der Praxis.
„Ting – ein Fonds für Demokratie“
Ting ist eine digitale Community, die Geld teilt. Ein gemeinsamer Fonds fördert gesellschaftlich sinnhafte Vorhaben und ermöglicht so demokratisches Handeln.
Wer sich gesellschaftlich einbringen will, braucht nicht nur Mut und Ideen, sondern auch Zeit, Spielraum und Sicherheit. Wie kann gemeinschaftlich geteiltes Geld, demokratisches Handeln ermöglichen? Genau hier setzt Ting an: Die Online-Community zahlt monatlich freiwillige Beiträge in einen solidarischen Fonds ein. Dieses Vermögen wird an diejenigen Mitglieder verteilt, die sich im Sinne der SDGs (Sustainable Development Goals) für soziale, ökologische oder gesellschaftliche Anliegen engagieren.
Ting ist mehr als ein Umverteilungsinstrument. Es wirkt als zivilgesellschaftlicher Katalysator, der Beteiligung erleichtert und kollektives Handeln fördert. Die Community entscheidet gemeinsam, welche Vorhaben unterstützt, werden: demokratisch, transparent, unbürokratisch. In 75 Minuten erfahrt ihr, wie das Modell funktioniert, welche Erfahrungen Ting damit gemacht hat – und welche beispielhaften Vorhaben bereits gefördert wurden.
„Resilient durch Rollenwechsel“
Ein Planspiel zeigt, wie öffentliche Institutionen antidemokratischem Druck begegnen können – mit konkreten Schritten und Impulsen für die eigene Praxis.
Demokratie stärken? Klingt gut – aber wie konkret? In einem Planspiel erlebten Bibliotheks-Führungskräfte, wie sich antidemokratischer Druck anfühlt – und wie sie in herausfordernden Situationen reagieren. Die Erfahrung hat gezeigt, welche Handlungsspielräume bereits da sind und was es braucht, um in Zukunft besser aufgestellt zu sein. Spoiler: Das Spiel hat gewirkt. Aus dem Planspiel entwickelten sich konkrete Schritte – intern wie extern. Dazu zählen Investitionen in die Deeskalationskompetenz der Mitarbeitenden über ein gemeinsames Verständnis von Demokratiestärkung im Verbund – mit klaren Werten und Handlungsfeldern, bis hin zur aktiven Beteiligung an Aktionstagen.
Am Beispiel der Berliner Bibliotheken zeigt sich, wie öffentliche Institutionen auch unter Druck handlungsfähig bleiben – und welche Impulse auch für andere hilfreich sein können. Diese lassen sich schließlich in einen Mini-Fahrplan für die eigene Praxis übersetzen.
„Weiterentwicklung der Europäischen Bürger*innenjury“
Adela King fragt: Wie kann die Europäische Bürger*innenjury Beteiligung stärken, neue Formate entwickeln und Vertrauen in Demokratie und Institutionen zurückgewinnen?
Polarisierung, digitale Echokammern und schwindendes Vertrauen in Institutionen fordern die Demokratie heraus. Ein Gegenentwurf ist die Europäische Bürger*innenjury – ein Netzwerk engagierter Menschen, das jährlich entscheidet, welche Stadt zur Europäischen Demokratiehauptstadt wird. Damit setzt die Jury Impulse für Zusammenhalt, Frieden und europäische Werte. Jurymitglieder stärken in kostenlosen Trainings ihre Kompetenzen in Demokratiearbeit und Bürger*innenbeteiligung, während neue Beteiligungsformate wie Umfragen oder Crowdsourcing-Kampagnen erprobt werden.Im Diskurs mit Adela King von der European Capital of Democracy geht es darum, wie die Jury funktioniert, welchen Mehrwert sie für die europäische Demokratie schafft und wie sie weiterentwickelt werden kann. Gemeinsam diskutiert ihr: Welche Hindernisse erschweren die Beteiligung? Welche Potenziale sind noch ungenutzt? Und welche Anreize braucht es, damit Bürger*innenjurys dauerhaft attraktiv bleiben?
„Politik neu denken: Kollaborative Ansätze verankern“
Pascal Müller-Scheiwiller denkt weiter: Wie können kollaborative Ansätze Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft verbinden – und dauerhaft in der Praxis verankert werden?
Politik und Verwaltung sind stark ausgelastet – es fehlt an Zeit, Methoden und oft auch an einer klaren Vision, wie große Ziele wie Netto-Null bis 2050 in konkrete Rahmenbedingungen übersetzt werden können. Gleichzeitig fällt es zivilgesellschaftlichen Akteur*innen und demokratischen Innovator*innen wie Bürger*innenräten schwer, an die etablierte Politik anzuknüpfen. Expedition Zukunft begegnet diesen Herausforderungen mit dem Space „Demokratie“: einem Raum, in dem neue Formate erprobt und Brücken zwischen Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gebaut werden.Im Diskurs mit Pascal Müller-Scheiwiller geht es um die Frage, wie Politik in ihrer Praxis neu gedacht werden kann. Welche kollaborativen Formate haben sich bereits bewährt? Welche brauchen neue Räume? Und wie lassen sie sich so verankern, dass sie dauerhaft Wirkung entfalten?
„Co-Creating Our City: Jugendbeteiligung durch Citizen Science“
Lea Gronenberg und Tobias Spöri zeigen: Wie können Städte Jugendbeteiligung wirksam verankern – und welche Chancen bietet Citizen Science für lokale Demokratieprozesse?
Junge Menschen wollen bei Themen mitwirken, die sie direkt betreffen – stoßen dabei aber oft auf verschlossene Türen. Städte wiederum möchten jugendliche Perspektiven einbeziehen, wissen jedoch häufig nicht, wie. Genau hier setzt Co-Creating Our City an: Das Citizen-Science-Projekt bringt junge Menschen und Entscheidungsträger*innen zusammen, um Beteiligung vor Ort weiterzuentwickeln. Als Citizen Scientists erkunden Jugendliche ihre Lebenswelten, stärken demokratische Kompetenzen und entwickeln Handlungsempfehlungen. In Pilotprojekten in Deutschland und den USA entstand ein Toolkit, das inspiriert, Jugendbeteiligung neu zu denken. Im Diskurs mit Lea Gronenberg und Tobias Spöri reflektiert ihr, welche Learnings daraus entstehen und wie Citizen Science Jugendbeteiligung in anderen lokalen Kontexten stärken kann. Welche Voraussetzungen braucht es, damit sie langfristig und wirksam verankert wird?
„Wer gehört wird, entscheidet mit: Räume demokratischer gestalten“
Elena Kalogeropoulos fragt: Wie können digitale Räume so gestaltet werden, dass marginalisierte Stimmen sichtbar werden und demokratische Aushandlung möglich ist?
Polarisierung und digitale Logiken verändern unsere Diskurse. Plattformen schaffen Sichtbarkeit nach Klicks, nicht nach Relevanz – das schwächt demokratische Resilienz und verstärkt Ausschlüsse. Demokratische Kommunikation scheitert oft an ungleichen Voraussetzungen – wer spricht, wer gehört wird, ist selten neutral.Im Diskurs mit Elena Kalogeropoulos von EK & the good lab geht es um die strukturelle Unsichtbarkeit marginalisierter und kritischer Perspektiven in (algorithmisierten) Konflikträumen. Anhand konkreter Beispiele erfahrt ihr, wie „Accountable Spaces“ Schutz und verantwortungsvolle Aushandlung verbinden – als Gegenentwurf zu reiner Sichtbarkeitslogik. Gemeinsam diskutiert ihr, welche Formate Rechenschaft und Machtkritik stärken und was es braucht, damit digitaler Raum konstruktiven Diskurs ermöglicht.
„Klick dich kritisch: Digitale Mündigkeit stärken“
Wie stärken wir Mündigkeit im Zeitalter der digitalen Transformation? Die „Digital Citizenship Education” liefert konkrete Ansätze.
Die digitale Welt verändert sich rasant, mit spürbaren Folgen für unsere Gesellschaft und Politik: Polarisierung, Filterblasen auf Social Media, zunehmende Radikalisierung oder der Einfluss häufiger KI-Nutzung auf das kritische Denken. Auch die politische Bildung ist gefragt, wenn es darum geht, auf diese Herausforderungen zu reagieren. Ein Ansatz dafür kommt vom Europarat: Digital Citizenship Education (DCE) fördert digitale Mündigkeit. In dieser Session lernt ihr das DCE-Handbuch mit seinen Kerninhalten kennen und bekommt konkrete Anregungen für eigenes Handeln in formalen wie non-formalen Bildungskontexten. In Kleingruppen arbeitet ihr mit Placemats – strukturierten Arbeitsvorlagen, die beim gemeinsamen Nachdenken, Diskutieren und Weiterentwickeln unterstützen.
„Digitale Resilienz braucht Vielfalt“
FLINTA* sind in der Nutzung von KI bisher unterrepräsentiert. Wie lässt sich künstliche Intelligenz gezielt und verantwortungsvoll eingesetzt werden – für mehr digitale Teilhabe?
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt – auch in der Zivilgesellschaft. Studien, die Männer und Frauen vergleichen, zeigen deutliche Unterschiede: Männer nutzen KI-Tools häufiger, schulen sich aktiver weiter und bringen sich stärker in strategische Diskussionen ein. Frauen dagegen äußern oftmals ethische Bedenken oder fühlen sich nicht ausreichend kompetent. Gerade im gemeinnützigen Sektor, in dem der Frauenanteil besonders hoch ist, droht so ein doppelter „Digital Gap” – zwischen Männern und Frauen sowie zwischen Profit- und Non-Profit-Sektor.Gleichzeitig ist klar: FLINTA* sind insgesamt in der Nutzung und Mitgestaltung dieser Technologien unterrepräsentiert. Genau hier setzt der Workshop an: Er richtet sich an FLINTA* aus gemeinnützigen Organisationen, die KI gezielt und verantwortungsvoll einsetzen wollen. Ziel ist es, dass ihr in eure digitale Selbstermächtigung stärkt und konkrete Wege kennenlernt, wie KI zur Professionalisierung und für eine nachhaltige Nutzung in der Zivilgesellschaft beitragen kann – durch strategische Impulse, Praxisbeispiele und kollegialen Austausch.
„Wenn Engagement unter Druck gerät“
Autoritäre Einstellungen gibt es auch in der Zivilgesellschaft. Wo treten sie auf, wer ist betroffen und wie können wir die demokratische Zivilgesellschaft stärken?
Zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen tragen zu einer starken Demokratie bei. Gleichzeitig finden sich auch in zivilgesellschaftlichen Strukturen rechtsextreme, autoritäre und demokratiefeindliche Kräfte. In diesem Workshop schaut ihr genau hin: Wie unterscheiden sich autoritäre Einstellungen zwischen Engagierten und Nicht-Engagierten? In welchen Feldern sind Menschen mit (rechts-)autoritären Haltungen aktiv? Und welche soziodemografischen Faktoren spielen dabei eine Rolle?Gemeinsam diskutiert ihr, welche Rahmenbedingungen und Strategien notwendig sind, um zivilgesellschaftliches Engagement zu stärken und widerstandsfähig gegenüber autoritären Einflüssen zu machen.
„Das österreichische Parlament auf TikTok & Co.“
Politik auf Social Media erklären, das macht der Newsroom des Parlaments seit drei Jahren. Zwei Redakteurinnen zeigen, warum es um mehr geht als nur „Likes“.
Das österreichische Parlament zeigt, wie Demokratiebildung funktionieren kann: Es bringt sie dorthin, wo viele Menschen den Großteil ihres Alltags verbringen: auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. Junge Menschen lernen über Demokratie und Parlamentarismus – und das nahbar und in einer Sprache, die ankommt. Wie erklärt man komplexe Inhalte in 90 Sekunden? Welche Fragen stellen Bürger*innen in TikTok-Livestreams zu Nationalratssitzungen? Was hat das österreichische Parlament in drei Jahren Demokratiebildung auf Social Media gelernt?
Ihr erfahrt, warum das Parlament auf der Plattform TikTok ist, welche Inhalte besonders gut funktionieren – und warum Likes nicht das einzige Ziel sind, wenn man demokratische Teilhabe fördern will.
„Panel: Mut zur Hoffnung“
Krisen erzeugen Angst und Ohnmacht – diese Gefühle können auch anders wirken. Dieses Panel zeigt, wie Emotionen als demokratische Ressourcen genutzt werden können.
Krisen unserer Zeit erzeugen Angst, Wut und Ohnmacht – Emotionen, die von antidemokratischen Kräften gezielt als Treibstoff genutzt werden. Während sie mit starken Gefühlen mobilisieren, bleiben demokratische Akteur*innen hingegen meist reaktiv und nutzen das Potenzial (positiver) Emotionen kaum strategisch. Das Panel liefert konkrete Antworten: Was wäre, wenn wir wieder pro-demokratische Zukunftsbilder entwerfen und daraus neue Hoffnung schöpfen? Wenn wir anerkennen, dass Demokratie und Emotionen untrennbar verbunden sind – und dass gerade Hoffnung Orientierung gibt, langfristig bindet und kollektive Handlungsfähigkeit stärkt? Und wie lässt sich Emotionalisierung bewusst als demokratische Kraft nutzen – für eine Kultur der Hoffnung statt der Angst?
Im Fokus steht die Analyse politischer Emotionen und demokratischer Diskurse. Wir teilen Erfahrungen aus zivilgesellschaftlicher Mobilisierung und fragen, wie Hoffnung in gesellschaftliche Transformation übersetzt werden kann – in Sprache, Narrativen und Kampagnen. Dahinter steht die Idee einer demokratischen Emotionskultur, die zeigt: Gefühle können Demokratie stark machen.
Das Panel wir moderiert von Florian Schmidt (Austria Presse Agentur).
„Kunst im Kollektiv“
Mitmacht 2025 bringt künstlerische Projekte zusammen, die Begegnungen ermöglichen und gesellschaftliche Missstände sichtbar machen.
Demokratie ist vielseitig erfahrbar. Über das ganze Mitmacht-Festival lang, wirken tolle Partner*innen und Projekte, unterschiedlich am Programm mit:
„listen&share“ ist eine begehbare Installation, die dazu einlädt, Fragen, Erfahrungen und Perspektiven gemeinsam zu erkunden. Besucher*innen hören einander zu, teilen Gedanken und gestalten so ein kollektives Bild dessen, was uns bewegt. (Gestaltet von Astrid Kirchhoff, Birger Strahl & Tobias Zucali)
Das Projekt Design Democracy setzt sich mit digitalen Postern für mehr Demokratie und Respekt im Netz ein. Gestalter*innen werden dazu aufgerufen, ihre Kunst in Form von Postern zu spenden. Design Democracy verbreitet diese Poster als visuelle Counterspeech auf Social Media, um damit einen Gegenpol zu diskriminierenden und extremistischen Inhalten zu bilden. (Gestaltet von Ravena Hengst)
Das Projekt „Demokratie, was geht?“ gibt jungen, marginalisierten Menschen Raum, ihre Gefühle und Visionen hör- und sichtbar zu machen. Bei Mitmacht gestalten Teilnehmende zwei Programmpunkte: Mit „Poetic Recording“ wird das Festival in Klang und Wort zu einer Performance verdichtet. Stimmen, Bilder, Geschichten und Stimmungen der Teilnehmenden verschmelzen zu einer lebendigen Poesie, die den Abend nachklingen lässt. (Gestaltet von Jonas Scheiner)
Die Lichtinstallation „Enlightening Stories“ zeigt auf kleinen Tafeln 3D-gedruckte Reliefbilder der Teilnehmenden. Unsichtbare Laserstrahlen tragen codierte Tonspuren – Geschichten der Jugendlichen, hörbar für alle, die aktiv zuhören. Wie auch in der Gesellschaft braucht es oft erst den bewussten Blick, um die Geschichten derer zu entdecken, die an den Rand gedrängt wurden. Hier stehen sie im Zentrum. (Gestaltet von Çağdaş Çeçen)
„Fuckup Night“
Offene Fehlerkultur schafft Vertrauen, ermöglicht mutiges Ausprobieren und wertvolle Erfahrungen. Bei der Fuckup Night teilen drei Teilnehmende ihre größten Learnings.
Eine offene Fehlerkultur ermöglicht es Menschen, Neues auszuprobieren, Risiken einzugehen und Erfahrungen zu teilen – ohne Angst, verurteilt zu werden. Fehler sind kein Zeichen von Schwäche, sondern die Basis und der Antrieb für Entwicklung und Veränderung. Auch wenn der Begriff der offenen Fehlerkultur nicht unbekannt ist, bleibt man hinter den Überschriften oft an der Oberfläche. Für echten Tiefgang braucht es eine vertrauensvolle Basis, die auch das gegenseitige Auffangen einschließt. Denn im Prozess der Auseinandersetzung werden Emotionen freigesetzt, die wir oft nicht erwarten. Erfahrungen an andere weiterzugeben bedeutet auch, den Wert des Erlebten zu erkennen. Da in unserer schnelllebigen Zeit die Reflexion zu kurz kommt, hat ihr Wert unheimlich zugenommen.
Bei der Fuckup Night berichten drei Festival-Teilnehmende in maximal 10 Minuten von ihren Erlebnissen, Fehlern und vor allem ihren Learnings. Wir freuen uns auf Geschichten von Katja Meier, Christian Pöltl-Dienst und Flurina Wäspi.
„Lab: Emotionen & Demokratie“
In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Emotionen als demokratische Kraft wirken – und wir so autoritären Tendenzen wirkungsvoll entgegentreten.
Autoritarismus überzeugt nicht mit Argumenten und Programmen, sondern agiert tiefer. Er kreiert mächtige kollektive Affekte und kanalisiert (un)bewusste Wünsche und Ängste. Demokratien reagieren darauf oft rational – mit Programm, Struktur und Appell. Doch ohne ein Verständnis der tief liegenden Affektdynamiken bleibt ihre Wirkung begrenzt. Unter welchen Bedingungen sind eine lebenswerte Zukunft und demokratische Ideale wieder vorstellbar? Fachexpert*innen und Interessierte erkunden gemeinsam, welche Rolle Emotionen in der Politik spielen und entwickeln strategische Ansatzpunkte, wie dieses Wissen gezielt in demokratische Bildungs-, Kommunikations- und Beteiligungsprozesse einfließen kann. Das Lab wird von Beyond Molotovs gehostet, einem Kollektiv, das sich seit 2020 mit anti-autoritären Gegenstrategien beschäftigt. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Alltagsorte und Demokratie“
In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Alltagsorte Begegnung, Zugehörigkeit und Vertrauen in die demokratische Gesellschaft stärken.
Demokratie wird nicht nur in Parlamenten erfahrbar, sondern überall dort gelebt und verhandelt, wo Menschen sich im Alltag begegnen: im Verein, beim Einkaufen, in der Bar oder auf dem Spielplatz. Diese Orte prägen, wie wir unsere Mitmenschen und auch Demokratie erleben. Doch heute schwinden viele dieser Orte, Begegnungen werden seltener und Menschen empfinden öffentliche Räume als unsicher.Welche Orte braucht es und wie können wir sie so gestalten, dass sie gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern? In diesem Lab entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Alltagsorte Begegnung, Zugehörigkeit und Zutrauen in die demokratische Handlungsfähigkeit und gesellschaftliche Zukunftsgestaltung stärken. Das Lab wird von More in Common gehostet, einer Organisation, die erforscht, was Gesellschaften zusammenhält und wie Vertrauen und Zugehörigkeit demokratischen Gesellschaften gestärkt werden können. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsler erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Beteiligung und Demokratie“
Wir bündeln Erfahrungen, um Beteiligung neu zu denken und Wege zu finden, wie sie Menschen wieder stärker verbindet.
Demokratie lebt davon, dass Menschen sich beteiligen und mitgestalten – doch vielerorts gelingt das immer weniger. Viele fühlen sich von politischen Prozessen ausgeschlossen oder werden nicht gehört. Gleichzeitig suchen Kommunen und Institutionen nach neuen Wegen, um den Dialog mit Bürger*innen zu stärken. Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten bringen wir bestehende Formate und Erfahrungen aus dem DACH-Raum zusammen, um sie zu bündeln, Synergien sichtbar zu machen und daraus gemeinsame Zukunftsbilder abzuleiten. Das Lab wird vom Schweizer Dachverband Partizipation gehostet, der sich für Qualität, Wirksamkeit und eine Kultur der Mitgestaltung in Partizipationsprozessen einsetzt. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Kollektives Wirken und Demokratie“
In diesem Lab entstehen Zukunftsbilder, in denen Ressourcen, Wissen und Strategien gebündelt werden, um die Demokratie nachhaltig zu stärken.
Demokratische Strukturen stehen unter Druck, während gesellschaftliche Herausforderungen immer komplexer werden. Fragmentierung, Konkurrenzdenken und fehlende Abstimmung verhindern, dass Initiativen ihr volles Potenzial entfalten. Um die Demokratie zukunftsfähig zu halten, braucht es neue Formen der Zusammenarbeit über Sektorgrenzen hinweg. Wie können gemeinsame Strategien entstehen und kollektive Wirkung entfaltet? Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten entwickeln wir Zukunftsbilder, in denen Kräfte gebündelt, Verantwortung geteilt und Allianzen geschaffen werden, um Veränderungen langfristig zu verankern. Das Lab wird von Phineo und Ashoka Austria gehostet – zwei Organisationen, die soziale Innovation, Wirkungsmessung und sektorübergreifende Zusammenarbeit fördern, um gemeinsames Handeln für die Demokratie zu stärken. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Lab: Digitale Öffentlichkeit und Demokratie“
In diesem Lab gestalten wir Zukunftsbilder für eine digitale Öffentlichkeit, die Hass und Desinformation wirksam entgegentritt und Zusammenhalt stärkt.
Hassrede und Desinformation untergraben Vertrauen, spalten Gesellschaften und gefährden die Grundlagen demokratischer Verständigung. Im Lab Digitale Öffentlichkeit & Demokratie beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Interventionen es gegen diese Dynamiken bereits gibt – und welche neuen Strategien es braucht, um digitale Räume zu stärken. Ausgangspunkt sind bestehende Ansätze beispielsweise aus Prävention und Bildung, Regulierung, Kommunikation, Nachsorge und Analyse. Gemeinsam mit Fachexpert*innen und Interessierten sichten wir, was vorhanden ist und wo noch Lücken bestehen. Das Lab wird von das NETTZ, der Vernetzungsstelle gegen Hass im Netz, gehostet, das Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik verbindet. Der methodische Rahmen wurde in Zusammenarbeit mit Zukunftsforscher Jonas Drechsel erarbeitet.
*Die Labs sind Denk- und Handlungsräume, in denen unterschiedliche Akteur*innen gemeinsame Zukunftsbilder für eine starke Demokratie entwerfen und erste Schritte dorthin denken – der Startpunkt eines ko-kreativen, sektorübergreifenden Prozesses. Grundlage sind Methoden aus der Zukunftsforschung (wie beispielsweise Futures Wheel), die dabei unterstützen, strategische Narrative zu formulieren und systemische Ziele für die kommenden Jahre abzuleiten.
„Keynote mit Kübra Gümüşay“
Kübra Gümüşay zeigt, wie Sprache Wirklichkeiten schafft – und wie wir mit Imagination neue demokratische Zukunftsbilder entwickeln können.
Sprache ist nie neutral – sie formt, was wir sehen, denken und für möglich halten. Sie kann demokratische Räume öffnen oder verschließen, Zugehörigkeit schaffen oder verweigern. Autorin und Publizistin Kübra Gümüşay beschreibt Sprache als Instrument, das unsere Wahrnehmung prägt und den Rahmen dessen bestimmt, was wir uns als veränderbar vorstellen.In ihrer Keynote verbindet sie diese Macht der Sprache mit dem Potenzial der Imagination: der Fähigkeit, sich gerechtere, inklusivere Zukünfte vorzustellen – und sie verhandelbar zu machen.
Wer darf Zukunft entwerfen? Und wie entwickeln wir gemeinsam Narrative, die Orientierung geben und demokratisches Handeln ermöglichen? Gerade in Zeiten, in denen autoritäre Kräfte gezielt Emotionen einsetzen, lädt Kübra Gümüşay dazu ein, Sprache und Vorstellungskraft als Räume für utopisches Denken zu begreifen. So entstehen Zukunftsbilder, die Hoffnung geben und Zugehörigkeit stärken.Diese Keynote ist ein Weckruf und eine Einladung zugleich: Sie ermutigt, neu zu denken, gemeinsam zu gestalten und Zugehörigkeit möglich zu machen. Eine Einladung aus kollektiver Vorstellungskraft, demokratische Stärke zu gewinnen.
„Wem gehört der Feed?“
Andrea Laura Bonk und Leon Erlenhorst sprechen darüber, wieso extremistische Narrative auf dem digitalen Spielfeld gewinnen – und wie wir den Trend umkehren können.
Durch Hetze, Desinformation und extremistischen Content gerät unsere Demokratie auch digital mehr und mehr unter Druck. Im Diskurs mit Media Force und der DFL Stiftung geht es darum, wie sich dieser Entwicklung wirksam begegnen lässt. Andrea Laura Bonk und Leon Erlenhorst verbinden datenanalytische und inhaltlich-kreative Strategien, um digitale Räume zurückzuerobern: Durch Datenanalysen werden Verhaltensmuster von Zielgruppen sichtbar. Dieses Wissen bildet die Grundlage für die Entwicklung demokratischer Narrative und Inhalte – insbesondere dort, wo junge Menschen ihre Meinungen bilden. Ihr diskutiert gemeinsam, wie Erkenntnisse aus Forschung, Kommunikation und digitaler Praxis zusammenwirken können, um die algorithmischen Gegebenheiten zu einem Vorteil zu nutzen.
„Demokratiebildung: Game based Learning mit One Up Island“
Christian Pöltl-Dienst spricht darüber, wie Game-based Learning junge Menschen für Demokratie begeistert und politische Bildung praxisnah und spielerisch erlebbar macht.
Politikverdrossenheit wächst, und viele junge Menschen erleben demokratische Prozesse als fern und abstrakt. Game-based Learning setzt hier an: Demokratie wird nicht nur erklärt, sondern spielerisch erfahrbar. Am Beispiel von One Up Island, einem von der Arbeiterkammer Wien entwickelten Spiel, erfahrt ihr, wie demokratische Entscheidungsprozesse erlebbar werden und junge Menschen für Teilhabe begeistert werden können. Im Diskurs mit Christian Pöltl-Dienst von der Arbeitekammer Wien geht darum, wie spielerische Formate Partizipation auf Augenhöhe fördern können. Ihr diskutiert: Wie stärkt Game-based Learning demokratische Kompetenzen in der Praxis? Welche Chancen und Grenzen hat der Einsatz von Spielen in der politischen Bildung? Und wie gelingt es, Jugendliche für Demokratie zu gewinnen?
„Wie wir im eigenen Umfeld aktiv werden können“
Katharina Jeschke zeigt, wie jede*r im eigenen Umfeld Demokratie stärken kann – vom Dialog in der Nachbarschaft bis hin zur Zusammenarbeit mit anderen Initiativen.
Gesellschaftliche Spaltung und Polarisierung nehmen zu. Viele Menschen fühlen sich nicht mehr gehört und in ihrer Lebenswelt isoliert. Das Projekt Österreich der Runden & Eckigen Tische schafft Räume für Begegnung und Verständigung. Im Diskurs mit Katharina Jeschke von Österreich der Runden & Eckigen Tische geht es um darum, wie jede*r im eigenen Umfeld aktiv werden kann. Ihr diskutiert, wie individuelle Beiträge größere Wirkung erzielen können: Welche Ressourcen lassen sich aktivieren? Was können wir voneinander lernen? Und wie kann die Zusammenarbeit mit anderen Initiativen gestärkt werden, um diesen zu fördern?
„Wiener Demokratie-Strategie: Für Mitbestimmung und Zusammenhalt“
Wencke Hertzsch spricht über die Wiener Demokratie-Strategie: Wie ein breiter Beteiligungsprozess Mitbestimmung stärkt und Demokratie in einer Großstadt neu verankern kann.
Wie kann eine Großstadt mit unterschiedlichen Akteur*innen ihre Demokratie stärken? Mit der neuen Demokratie-Strategie schafft die Stadt Wien einen Rahmen, um demokratische Kultur gezielt auszubauen. Ziel ist es, möglichst vielen Wiener*innen – unabhängig von ihren Lebensrealitäten – Mitgestaltung zu ermöglichen. Die Strategie wurde, bis Frühjahr 2025 in einem offenen Beteiligungsprozess erarbeitet: mit Workshops in den Bezirken, Online-Formaten, Fachgesprächen und Veranstaltungen, die gezielt Gruppen einbanden, denen sonst selten zugehört wird. Der Entwurf wurde zudem auf der Beteiligungsplattform veröffentlicht, um Feedback aus der Bevölkerung einzuholen. Im Diskurs mit Wencke Hertzsch von der Stadt Wien geht es um die nächsten Schritte: Wie wird aus einem Strategiepapier gelebte Praxis? Und wie lässt sich Beteiligung dauerhaft in Verwaltung und Politik verankern, um Mitbestimmung, Transparenz und Zusammenhalt zu stärken?
„Campaigning 101: Gemeinsam Veränderung bewirken“
Wie können Bürger*innen Veränderungen bewirken? #aufstehen zeigt, wie zivilgesellschaftliches Campaigning demokratische Prozess anstößt und stärkt.
Demokratie lebt von einer aktiven Zivilgesellschaft. Doch wie gelingt es Bürger*innen mitzugestalten und gesellschaftliche Veränderung zu bewirken? #aufstehen stellt Good-Practices vor, die zeigen, wie zivilgesellschaftliches Campaigning demokratische Mitgestaltung ermöglicht. Ihr bekommt konkrete Strategien für wirkungsvolle Kampagnen an die Hand: zentrale Taktiken, wichtige Erfolgsfaktoren und die Frage, wie Zivilgesellschaft strategisch vorgehen kann, um demokratische Prozesse anzustoßen und mitzugestalten? Im Praxisteil entwickelt ihr eigene Kampagnenideen und erfahrt, was eine erfolgreiche Petition ausmacht. Gemeinsam erarbeitet ihr, wie digitale Tools demokratische Mitgestaltung stärken – und wie jede*r Einzelne zu einer lebendigen Demokratie beitragen kann.
„Von der Diktatur in die Demokratie – ein Lernprozess?“
Geflüchtete aus Diktaturen stoßen auf Hürden der Teilhabe. Politische Bildung kann mit kultursensiblen Zugängen neue Räume öffnen und Communities stärken.
Wer aus einer Diktatur flieht, hat kaum Erfahrung mit demokratischen Strukturen und wird in Aufnahmeländern oft lange von politischer Teilhabe ausgeschlossen. Sprachbarrieren, fehlende kultursensible Angebote und schwache Netzwerke erschweren den Zugang zusätzlich – für Betroffene und Bildungsprojekte. Das Projekt „Demokratie Leben“ stärkt geflüchtete Migrant*innen in der ganzen Schweiz mit interaktiver, kultursensibler politischer Bildung in der Sprache Tigrinya. Im Workshop erfahrt ihr mehr über die Situation der eritreischen Diaspora und diskutiert anhand von Praxisbeispielen Herausforderungen und Chancen politischer Bildung in diasporischen Kontexten. Gemeinsam entwickelt ihr Transferideen für andere migrantische Communities und erarbeitet Impulse für eine bessere Vernetzung zwischen Diaspora-Organisationen und Bildungsinstitutionen.
„Im Visier: Angriffe auf Demokratie und Verwaltung“
Wie kann Verwaltung die freiheitlich demokratische Grundordnung schützen, ohne ihre politische Neutralität zu verlieren? Ein Erste-Hilfe-Kit gibt Antworten.
Die Demokratie in Deutschland steht zunehmend unter Druck – und auch die Verwaltung wird ins Visier genommen. Persönliche Angriffe auf Mitarbeitende, Gewaltandrohungen oder Versuche, demokratische Prozesse zu delegitimieren, sind keine Einzelfälle mehr. Gerade hier stellt sich die Frage: Wie kann Verwaltung ihre Pflicht zur Verfassungstreue klar wahrnehmen, ohne Zweifel an ihrer parteipolitischen Neutralität aufkommen zu lassen? Der Workshop stellt ein Erste-Hilfe-Kit vor – ein Instrument, das Orientierung gibt, wenn Institutionen unter Druck geraten. Ihr erarbeitet gemeinsam, wie dieses Werkzeug weiterentwickelt werden kann, um noch mehr Handlungssicherheit zu schaffen. Am Ende der Session habt ihr Anlaufstellen und Werkzeuge an der Hand, um – innerhalb oder außerhalb der Verwaltung – aktiv zur Verteidigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung beizutragen.
„Web@ngels im Einsatz gegen Hass im Netz“
Hassrede bedroht Debattenkultur und Demokratie. Das Projekt Web@ngels zeigt praxisnah, wie ihr wirksam gegen Hass im Netz vorgeht.
Hassrede ist in Online-Diskussionen zur Normalität geworden – mit Folgen für Betroffene und dem demokratischen Diskurs insgesamt. Wenn sich konstruktive Stimmen zurückziehen, entsteht mehr Raum für Echokammern. Das Projekt Web@ngels zeigt, wie digitale Zivilcourage konkret aussehen kann. In einer interaktiven Session analysiert ihr in Kleingruppen reale Beispiele von Diskriminierung im Netz und entwickelt eigene Gegenredestrategien. Diese werden anschließend im Plenum diskutiert, verglichen und gemeinsam weitergedacht. Dabei schärft ihr euer Verständnis für die Dynamiken von Online-Diskriminierung, nutzt praxisnahe Methoden digitaler Zivilcourage und nehmt hilfreiche Tools für eure eigene Projekte und Initiativen mit.
„LOS jetzt! Bürger*innenräte wollen Demokratie fördern“
Wie können ehemalige Teilnehmende eines Bürger*innenrats zu Botschafter*innen der Demokratie werden? Das Projekt „LOS jetzt“ zeigt neue Wege mit Spiel, Erfahrung und Dialog.
Wie können junge Menschen ihre Erfahrungen aus Bürger*innenräten weitertragen und andere dafür begeistern? Das Projekt „LOS jetzt“ zeigt, wie ehemalige Teilnehmende aus der Schweiz, Deutschland und Österreich neue Ideen der Vermittlung entwickelt haben. Ihr Ziel: das Losverfahren in ihrer Peer-Group und gegenüber Entscheidungsträger*innen sichtbarer zu machen. Entstanden ist ein Kartenspiel, das zentrale Elemente von Demokratie und Bürger*innenräten spielerisch vermittelt.
In diesem Beitrag testet ihr das Kartenspiel und tauscht euch mit jungen Beteiligten aus. Im gemeinsamen Dialog entwickelt ihr Ideen: Wie kann ein Alumninetzwerk wachsen? Wie können spielerische Ansätze neue Beteiligungsformate fördern? Und was können wir alle von jungen Demokraten*innen lernen?
„Vermittlung von Media Literacy in Schulen“
Im Gespräch mit Florian Schmidt von der APA: Wie können Faktenchecks und Recherchetechniken in Schulen vermittelt werden, damit Jugendliche Desinformation besser erkennen und einordnen?
Desinformation, Fake News und KI-generierte Inhalte prägen den digitalen Alltag – besonders für junge Menschen, die täglich mit einer Flut an Informationen konfrontiert sind. Während in der Faktencheck-Community seit Jahren erprobte Methoden zur Überprüfung von Quellen existieren, sind diese Techniken in der breiten Bevölkerung noch wenig bekannt. Im Diskurs mit Florian Schmidt von der Austria Presse Agentur (APA) geht es darum, wie Media Literacy frühzeitig gestärkt werden kann. Die APA entwickelt derzeit eine Lernplattform, die Lehrer*innen und Schüler*innen praxisnah an das journalistische Handwerk heranführt – von der Quellenprüfung bis zur Bildanalyse. Gemeinsam diskutieren wir, wie Jugendliche im digitalen Alltag besser unterstützt werden können, welche Kompetenzen sie für einen kritischen Umgang mit Online-Inhalten brauchen und wie Schulen zu zentralen Lernorten für digitale Mündigkeit werden können.
„Die Kraft der Dritten Orte“
Sarah Schneider stößt an: Wie können Dritte Orte zu offenen Räumen werden, die Vielfalt fördern, Konflikte aushalten und demokratischen Zusammenhalt stärken?
Wie können Begegnungsorte in polarisierten Zeiten offen, vielfältig und resilient bleiben? Dritte Orte zeigen: Demokratie wird hier praktisch erlebt. Hier treffen sich Menschen, die sonst selten in Kontakt kommen – über Generationen und Lebenswelten hinweg. Ein Beispiel dafür ist das KörberHaus in Hamburg-Bergedorf: Neun Partnerorganisationen gestalten einen Ort, an dem Engagement, Kultur und Bildung unter einem Dach zusammenfinden. Im Diskurs mit Sarah Schneider von der Körber-Stiftung geht es darum, wie solche Dritten Orte den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken können. Welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft bei ihrer Sicherung? Und welche Strategien und Allianzen braucht es, um sie dauerhaft als Räume für Vielfalt und demokratisches Lernen zu verankern?
„Zwischen Gewinn und Gemeinwohl“
Wirtschaft und Demokratie stärken sich gegenseitig. Business Council for Democracy zeigt, wie Unternehmen Verantwortung für gesellschaftlichen Zusammenhalt übernehmen können.
Wirtschaft und Demokratie sind unverzichtbare Partner für eine wehrhafte Gesellschaft. Eine stabile Demokratie ist auf eine gesunde Wirtschaft angewiesen – und umgekehrt. Doch beide geraten zunehmend unter Druck: Globale Herausforderungen und gesellschaftliche Polarisierung erschüttern die Fundamente unseres Zusammenlebens. Es braucht neue Allianzen und ein klares Bekenntnis zu gemeinsamen Werten. In diesem Beitrag lernt ihr das Projekt Business Council for Democracy (BC4D) als Motor für mehr unternehmerische Verantwortung, Dialog und konstruktiven Streit kennen. Der BC4D motiviert Unternehmen, Haltung zu zeigen, Polarisierung entgegenzuwirken und die Debattenkultur im Betrieb zu stärken. So wird die Wirtschaft als oft unterschätzte, aber essenzielle Ressource für demokratische Resilienz aktiviert.
„Raus aus der Blase - mit Strategie & Empathie“
Lebendige Demokratie braucht Beteiligung und spiegelt Vielfalt. Wie gelingt es, neue Menschen zu erreichen, vielfältiger zu werden und Brücken über die eigene Blase hinaus zu bauen?
Einladungen erreichen häufig immer wieder dieselben Menschen. Netzwerke bleiben geschlossen, Stimmen wiederholen sich – und die eigene Bubble verstärkt sich selbst. Wie lassen sich Brücken zu Menschen bauen, die bisher nicht erreicht wurden? Der Workshop bietet euch strategische und empathische Impulse sowie konkrete Werkzeuge, um vielfältige Verbündete für euer Anliegen zu gewinnen. Mit Methoden wie dem „Spektrum der Verbündeten“ und „Empathy Talk“ eröffnet ihr Zugänge zu neuen Perspektiven, kommt in Verbindung und schafft eine Basis zum Brückenbau.Hinweis: Brücken entstehen nicht in einer Stunde – doch mit Neugierde und nützlichem Werkzeug wächst Stück für Stück ein stabiles Fundament.
„DemocracyGPT: KI im Dienst der Demokratie“
Können KI-Agenten die Demokratie stärken? Das Projekt „DemocracyGPT” testet Prototypen, die Quellen aufbereiten, Argumente liefern und neue Sichtweisen öffnen.
Künstliche Intelligenz durchdringt zunehmend alle Lebensbereiche – doch ihr Potenzial für die Demokratie bleibt bisher weitgehend ungenutzt. Dabei könnten KI-Tools Barrieren der Partizipation senken und politische Entscheidungen fundierter machen. Das Projekt „DemocracyGPT“ entwickelt KI-Agenten, die verständlich informieren, Perspektiven sichtbar machen und zur Meinungsbildung beitragen. Im Workshop testet ihr Prototypen: Wie gut gelingt KI-gestützte Orientierung in politischen Fragen? Welche Chancen eröffnen sich, wo zeigen sich Grenzen? Und wie reagieren Menschen, wenn Maschinen beim Denken unterstützen? Ihr erlebt die Tools live, entwickelt eigene Anwendungsideen – und nehmt einen Bauplan mit, um selbst Prototypen umzusetzen.
„Demokratie braucht Räume: Beteiligung als politische Praxis“
Lokale Beteiligung braucht Orte. Welche Formen kann das annehmen? Und wie gewinnt man Politik dafür?
Demokratie lebt vom Mitmachen – doch dafür braucht es Orte, an denen Menschen sich begegnen, einbringen und gemeinsam gestalten. Genau hier setzen die Projekte „Orte der Demokratie“ und das „Erfahrungs- und Beteiligungsnetzwerk Bürgerbeteiligung“ an: Sie schaffen Raum für politische Teilhabe, stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und fördern konkrete Vorhaben, in denen Mitbestimmung erlebbar wird. Das kann ein Chor, ein altes Postamt, Mitmachgarten oder eine Dorfbibliothek sein.
In dieser Session erfahrt ihr, warum solche Begegnungsräume besonders auf kommunaler Ebene notwendig sind, wie sie entstehen – und welche politischen Rahmenbedingungen es dafür braucht. Praxisbeispiele zeigen, wie verschiedene Zielgruppen in Beteiligungsprozesse eingebunden werden. Ideal für alle, die Beteiligung nicht nur denken, sondern aktiv gestalten wollen.
„From Collective Action to Policy Impact“
Ein Praxisbeispiel zeigt, wie zivilgesellschaftliche Akteur*innen ihre Erkenntnisse in politische Forderungen übersetzen und politische Veränderungen bewirken.
Wie können Erkenntnisse aus der Zivilgesellschaft gebündelt, aufbereitet und in wirksame politische Empfehlungen übersetzt werden? Gerade im Bereich Desinformation gibt es bereits jede Menge Forschung und Monitoring. Was oft fehlt, sind die nächsten Schritte: Erkenntnisse bündeln, politische Forderungen formulieren und gemeinsam institutionelle Veränderungen initiieren. Es braucht eine strategische zivilgesellschaftliche Linie, die sich dafür einsetzt.
In dieser Session lernt ihr ein Good-Practice Beispiel kennen, bei dem genau das gelungen ist: Die „Empfehlungen an die neue Bundesregierung für ein unabhängiges und wirksames Desinformationsmonitoring im digitalen Raum“. Denn Teile dieser Empfehlung sind in den Koalitionsvertrag der neuen deutschen Bundesregierung eingeflossen.
„Community und Campaigning: so wird Wirkung möglich“
Wie Communities und Campaigning zusammenwirken: In Kleingruppen entstehen Strategien für berufliche Herausforderungen und wirkungsvolle Mobilisierung.
Communities und Campaigning – zwei Bereiche, die im NGO-Alltag oft noch getrennt voneinander gedacht werden. Die einen setzen auf die langfristige Beziehungspflege mit engagierten Aktivist*innen, die anderen mobilisieren für konkrete politische Ziele. Doch Wirksamkeit entsteht, wenn beides zusammenkommt: starke Kampagnen, getragen von engagierten Communities.
In dieser Session erfahrt ihr, wie dieser Schulterschluss gelingt – auch mit begrenzten Ressourcen. Ihr lernt Strategien kennen, wie sich politische Inhalte durch Amplification – also gezielte Community-Arbeit – wirkungsvoll verstärken lassen. Im Mittelpunkt stehen konkrete Umsetzungen aus der Praxis: Was funktioniert wirklich? Und was lässt sich auf andere Organisation übertragen? Im interaktiven Teil arbeitet ihr in sogenannten „Case Clinics“: Kleingruppenformate, an denen ihr reale Herausforderungen aus eurem Berufsleben einbringt – und gemeinsam Lösungsansätze entwickelt, die über den Workshop hinaus wirken
„Kunst im Kollektiv“
Mitmacht 2025 bringt künstlerische Projekte zusammen, die Begegnungen ermöglichen und gesellschaftliche Missstände sichtbar machen.
Demokratie ist vielseitig erfahrbar. Über das ganze Mitmacht-Festival lang, wirken tolle Partner*innen und Projekte, unterschiedlich am Programm mit:
„listen&share“ ist eine begehbare Installation, die dazu einlädt, Fragen, Erfahrungen und Perspektiven gemeinsam zu erkunden. Besucher*innen hören einander zu, teilen Gedanken und gestalten so ein kollektives Bild dessen, was uns bewegt. (Gestaltet von Astrid Kirchhoff, Birger Strahl & Tobias Zucali)
Das Projekt Design Democracy setzt sich mit digitalen Postern für mehr Demokratie und Respekt im Netz ein. Gestalter*innen werden dazu aufgerufen, ihre Kunst in Form von Postern zu spenden. Design Democracy verbreitet diese Poster als visuelle Counterspeech auf Social Media, um damit einen Gegenpol zu diskriminierenden und extremistischen Inhalten zu bilden. (Gestaltet von Ravena Hengst)
Das Projekt „Demokratie, was geht?“ gibt jungen, marginalisierten Menschen Raum, ihre Gefühle und Visionen hör- und sichtbar zu machen. Bei Mitmacht gestalten Teilnehmende zwei Programmpunkte: Mit „Poetic Recording“ wird das Festival in Klang und Wort zu einer Performance verdichtet. Stimmen, Bilder, Geschichten und Stimmungen der Teilnehmenden verschmelzen zu einer lebendigen Poesie, die den Abend nachklingen lässt. (Gestaltet von Jonas Scheiner)
Die Lichtinstallation „Enlightening Stories“ zeigt auf kleinen Tafeln 3D-gedruckte Reliefbilder der Teilnehmenden. Unsichtbare Laserstrahlen tragen codierte Tonspuren – Geschichten der Jugendlichen, hörbar für alle, die aktiv zuhören. Wie auch in der Gesellschaft braucht es oft erst den bewussten Blick, um die Geschichten derer zu entdecken, die an den Rand gedrängt wurden. Hier stehen sie im Zentrum. (Gestaltet von Çağdaş Çeçen)
„Die demokratische Antwort: Ein neues Drehbuch für unsere Zeit“
Autoritäre schreiben längst an ihrem Drehbuch. Der Auftakt von Mitmacht 2025 stellt die Frage: Wie bleibt Demokratie handlungsfähig? Mit einer Keynote von Jeannette Gusko, einem Panel in Kooperation mit dem European Forum Alpbach und Raum für Austausch.
Autoritäre sind längst am Werk. Jetzt entscheidet sich, ob Demokratien den Takt vorgeben. Nach den Eröffnungsworten von Jürgen Czernohorszky ruft Jeannette Gusko zu einer neuen Kultur des Miteinanders auf, die sektorübergreifend wirkt, gemeinsame Werte trägt und kollektive Handlungsfähigkeit stärkt.
Marie Ringler eröffnet das Panel „Das autoritäre Drehbuch – und die demokratische Antwort darauf“, veranstaltet in Kooperation mit dem European Forum Alpbach. Daniel Binswanger, Natascha Strobl und Marie Ringler diskutieren, wie wir von der Analyse zu Strategien kommen, die Wirkung entfalten. Der Abend wird von Hannah Göppert moderiert, das Panel von Nina Schnider.
Im Anschluss gibt es Raum für Austausch und die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu stärken. Wer Demokratie nicht nur verteidigen, sondern gestalten will, sollte diesen Abend nicht verpassen.
Das Mitmacht-Festival startet mit diesem Abend. Organisiert von Faktor D, dem strategischen Netzwerk für Demokratie im deutschsprachigen Raum in Partnerschaft mit der Stadt Wien, der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Europäischen Forum Alpbach und Demokratie, was geht? Am Mitmacht-Festival kommen Expert*innen aus der gesamten deutschsprachigen Demokratiewelt vom 19. bis 22. November in Wien zusammen, um sich abzustimmen: Wie können wir als demokratische Kräfte zielgerichtet an einem Strang ziehen?
„Kunst im Kollektiv“
Mitmacht 2025 bringt künstlerische Projekte zusammen, die Begegnungen ermöglichen und gesellschaftliche Missstände sichtbar machen.
Demokratie ist vielseitig erfahrbar. Über das ganze Mitmacht-Festival lang, wirken tolle Partner*innen und Projekte, unterschiedlich am Programm mit:
„listen&share“ ist eine begehbare Installation, die dazu einlädt, Fragen, Erfahrungen und Perspektiven gemeinsam zu erkunden. Besucher*innen hören einander zu, teilen Gedanken und gestalten so ein kollektives Bild dessen, was uns bewegt. (Gestaltet von Astrid Kirchhoff, Birger Strahl & Tobias Zucali)
Das Projekt Design Democracy setzt sich mit digitalen Postern für mehr Demokratie und Respekt im Netz ein. Gestalter*innen werden dazu aufgerufen, ihre Kunst in Form von Postern zu spenden. Design Democracy verbreitet diese Poster als visuelle Counterspeech auf Social Media, um damit einen Gegenpol zu diskriminierenden und extremistischen Inhalten zu bilden. (Gestaltet von Ravena Hengst)
Das Projekt „Demokratie, was geht?“ gibt jungen, marginalisierten Menschen Raum, ihre Gefühle und Visionen hör- und sichtbar zu machen. Bei Mitmacht gestalten Teilnehmende zwei Programmpunkte: Mit „Poetic Recording“ wird das Festival in Klang und Wort zu einer Performance verdichtet. Stimmen, Bilder, Geschichten und Stimmungen der Teilnehmenden verschmelzen zu einer lebendigen Poesie, die den Abend nachklingen lässt. (Gestaltet von Jonas Scheiner)
Die Lichtinstallation „Enlightening Stories“ zeigt auf kleinen Tafeln 3D-gedruckte Reliefbilder der Teilnehmenden. Unsichtbare Laserstrahlen tragen codierte Tonspuren – Geschichten der Jugendlichen, hörbar für alle, die aktiv zuhören. Wie auch in der Gesellschaft braucht es oft erst den bewussten Blick, um die Geschichten derer zu entdecken, die an den Rand gedrängt wurden. Hier stehen sie im Zentrum. (Gestaltet von Çağdaş Çeçen)
„Herzlich Willkommen bei Mitmacht 2025!“
Soft-Opening mit Kaffee, Kuchen und Kennenlernen: Gemeinsam starten wir ins Festival, mit dem Radioballett „Wohlstandsparadox“ und dem Pub-Quiz „Kollektive Intelligenz“.
Das Mitmacht-Festival startet mit einem Soft-Opening am Mittwochnachmittag. Bei Kaffee und Kuchen gibt es ein gemütliches Ankommen und erstes Kennenlernen der Festival-Teilnehmenden. Von dem Faktor D-Team erhaltet ihr am Check-in Desk alle notwendigen Informationen und Materialien für die kommenden Tage.
Um ungefähr 15:00 Uhr startet Isabell Kolditz vom Körperfunkkollektiv mit dem „Wohlstandsparadox“. Das Stück hinterfragt in Form eines Radioballetts, wie Reichtum und Armut in einem wohlhabenden Land definiert und wahrgenommen werden. Es regt dazu an, über gesellschaftliche Wertvorstellungen und die ungleiche Verteilung von Wohlstand nachzudenken. Bitte nehmt dafür euer Handy und Kopfhörer mit. Parallel dazu gibt es beim Karlsplatz bei Schönwetter eine gemeinsame kreative Straßenaktion, wo wir den (Karls-)Platz der Demokratie gestalten.
Um 16:00 Uhr startet das Pub-Quiz „Kollektive Intelligenz“. Die Teilnehmer*innen treten gegen KI-Bots an und müssen erraten, welche politischen Zitate echt und welche von der KI erfunden sind. Das Spiel möchte auf spielerische Weise Bewusstsein für Fehlinformation, Medienwandel und demokratische Diskurse schaffen.
Über Mitmacht 2025
Bilder, Zahlen und vieles mehr
Über Faktor D
Team, Werte und Hintergründe
Mehr Angebote
So kannst du mitmachen
Vielen Dank
Wir danken den Partner*innen und Förder*innen des Mitmacht-Festivals 2025.


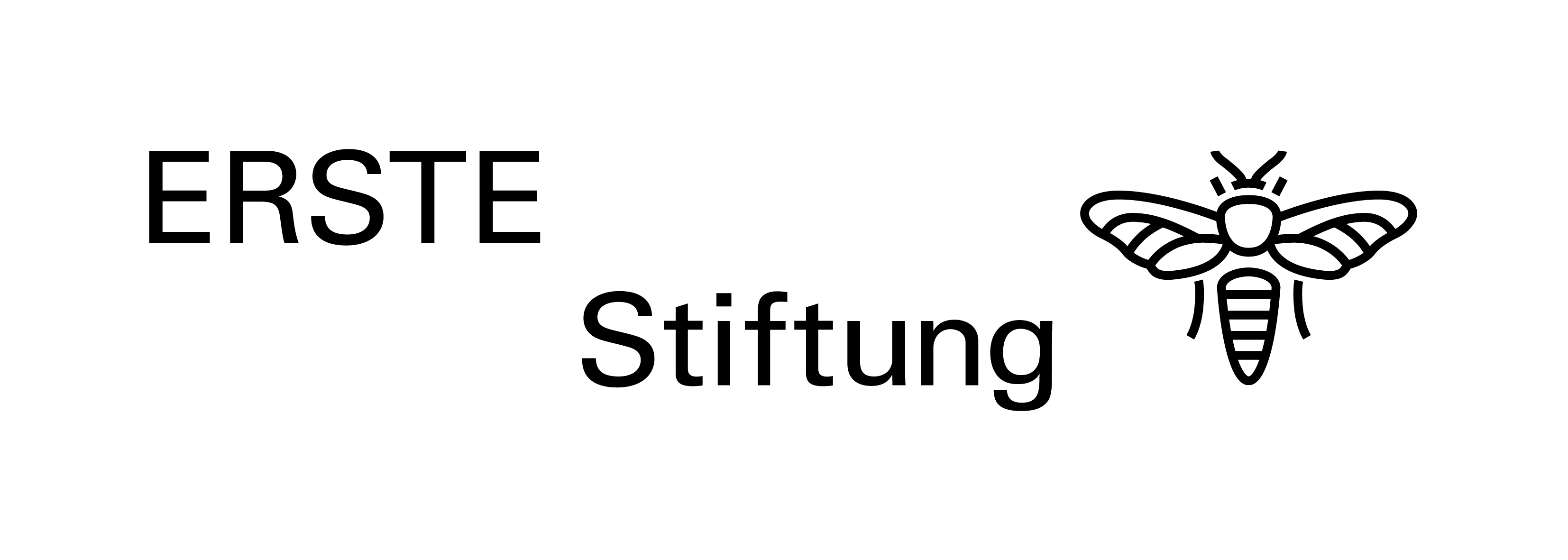
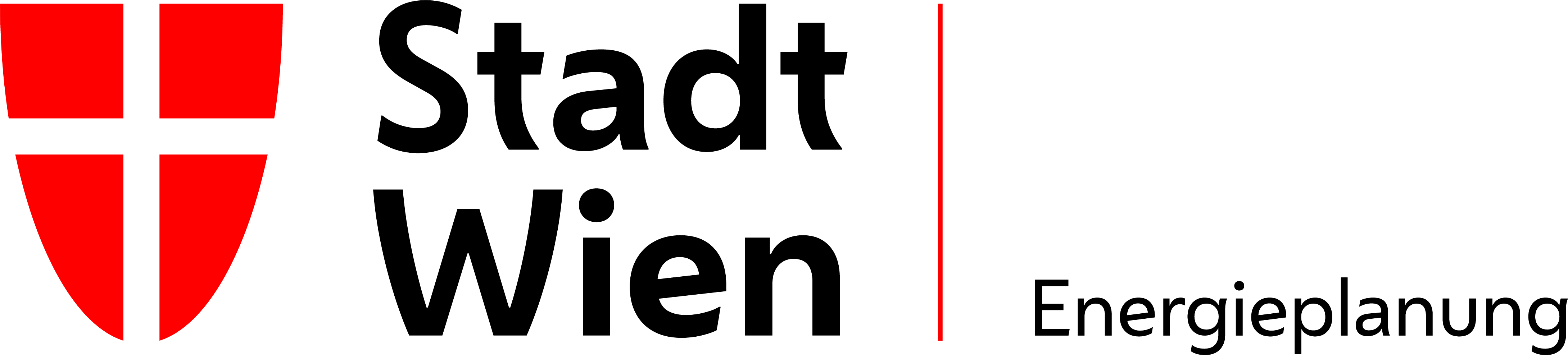


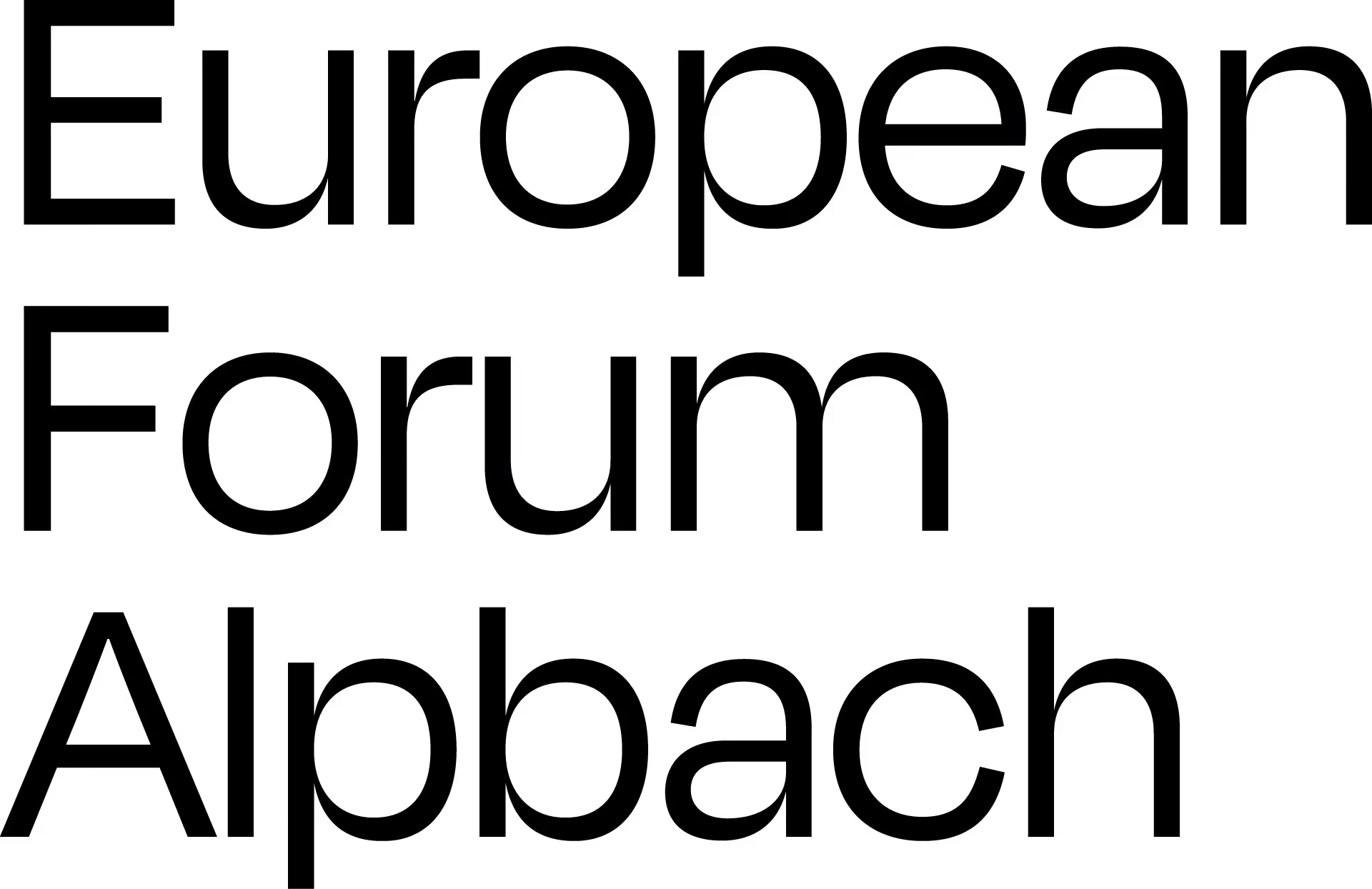
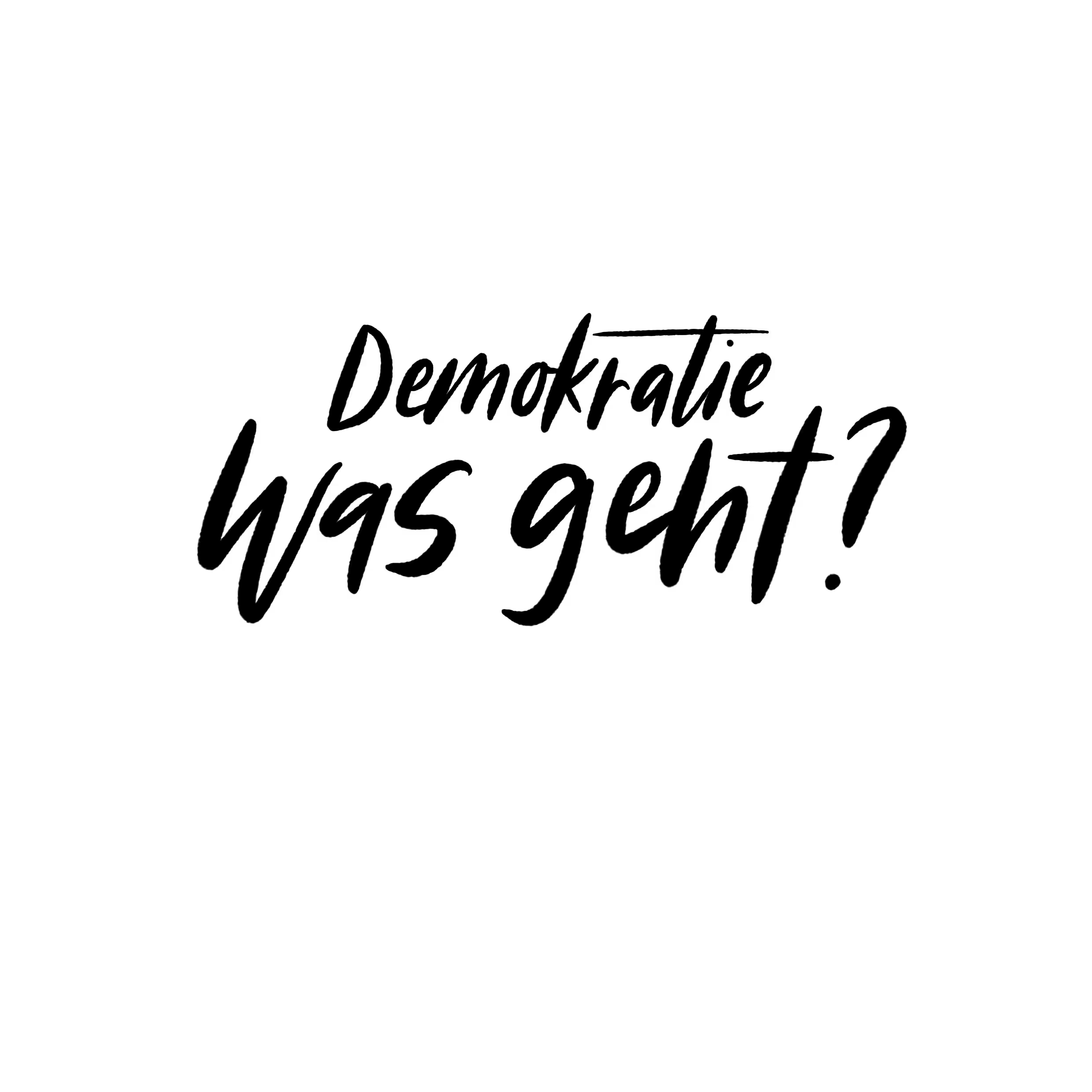
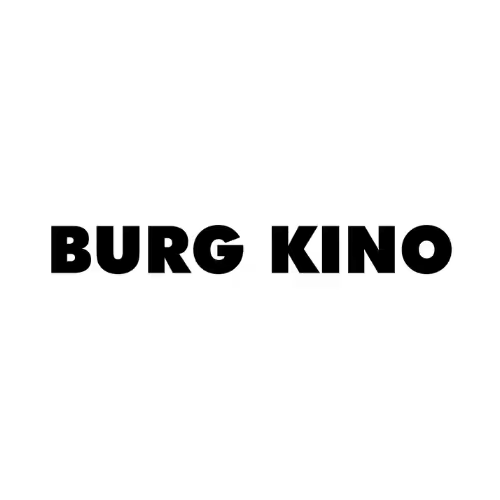












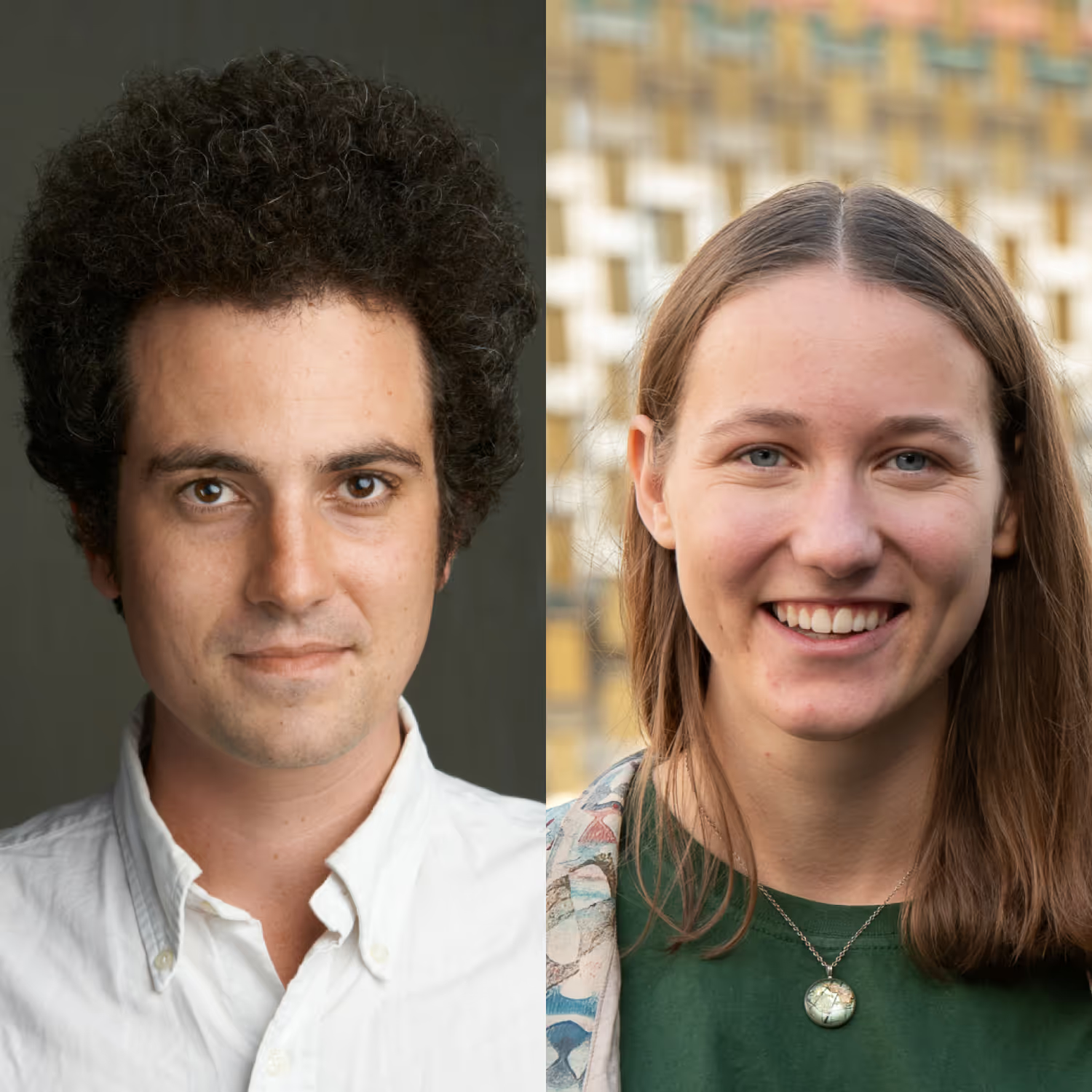









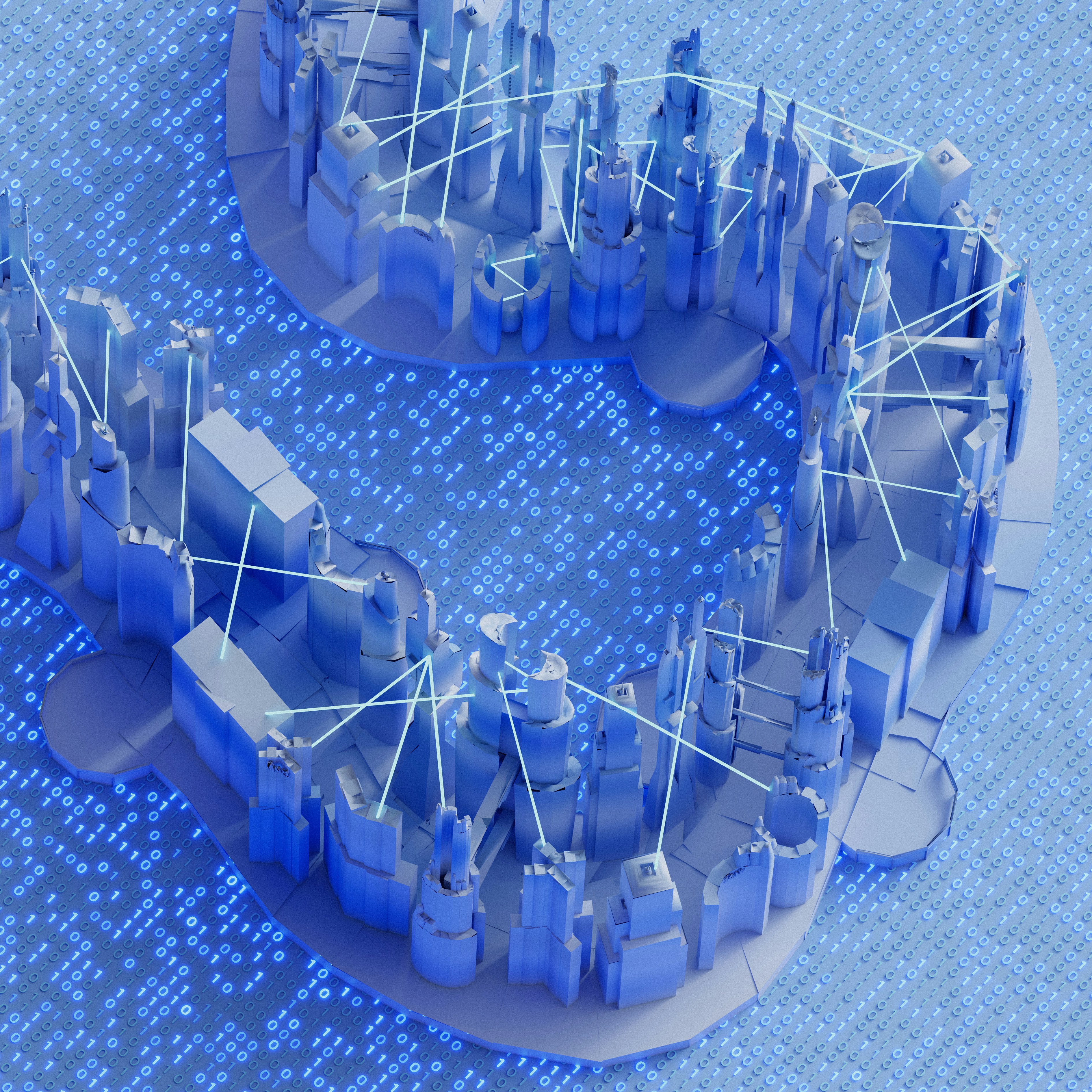
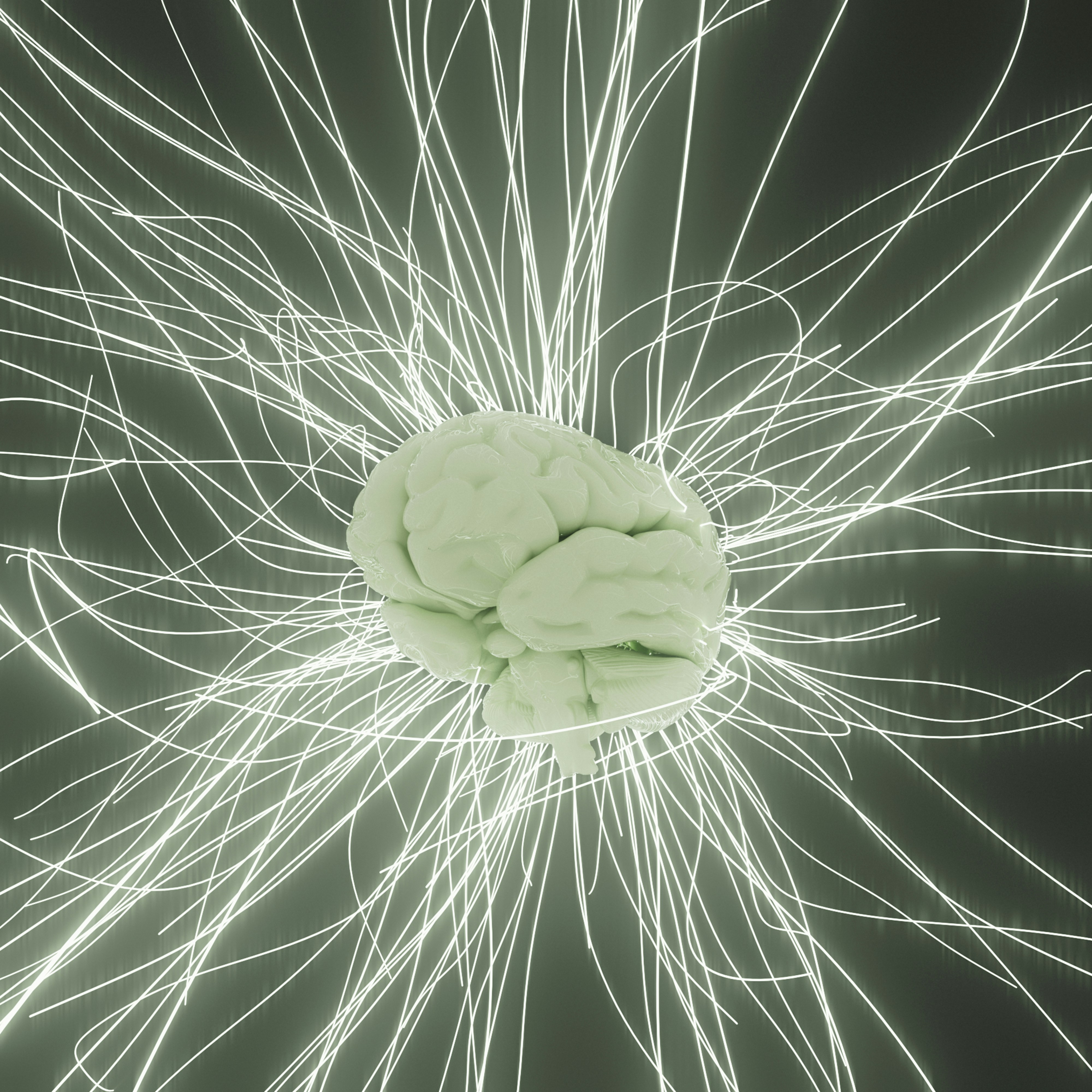
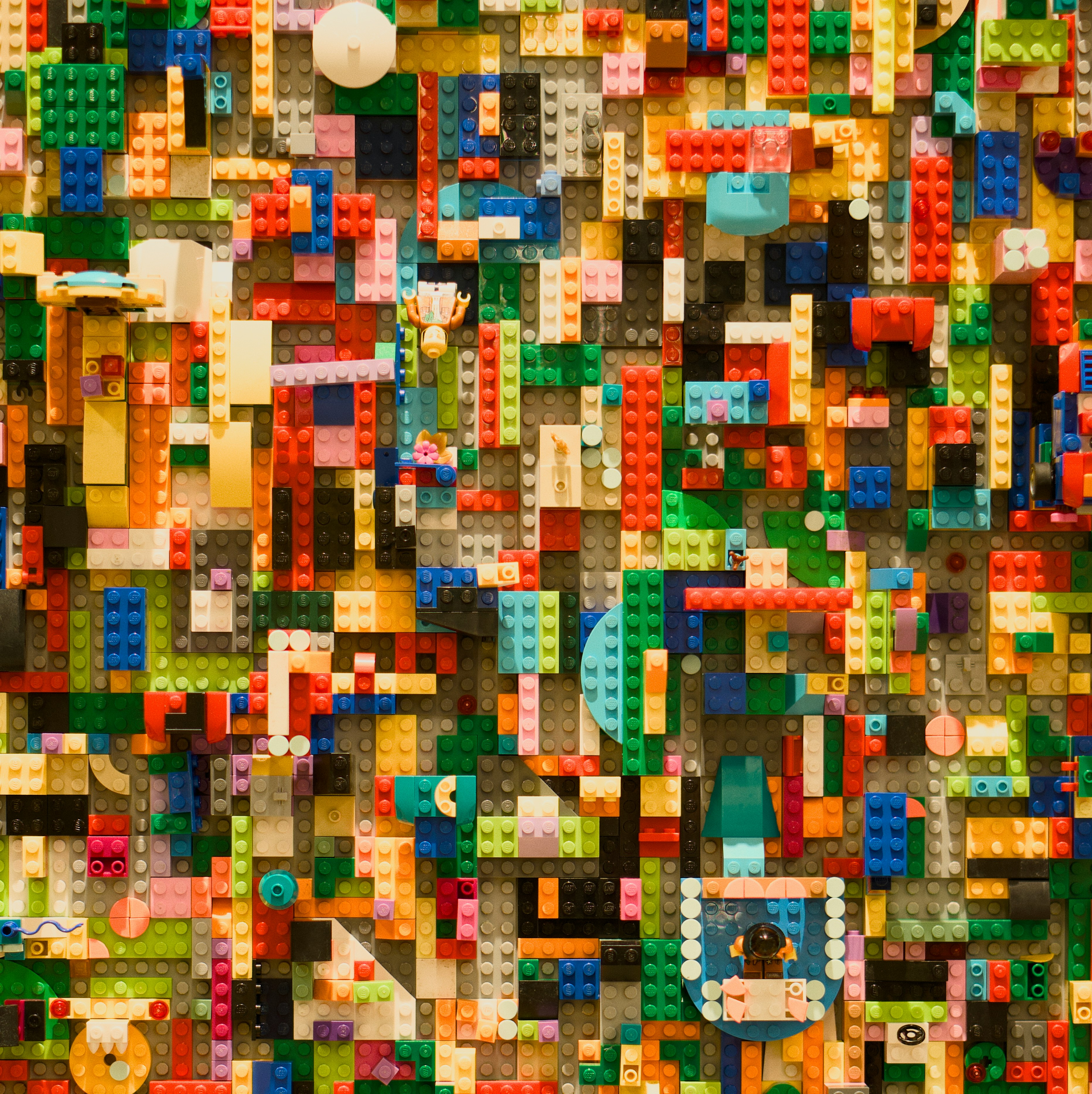
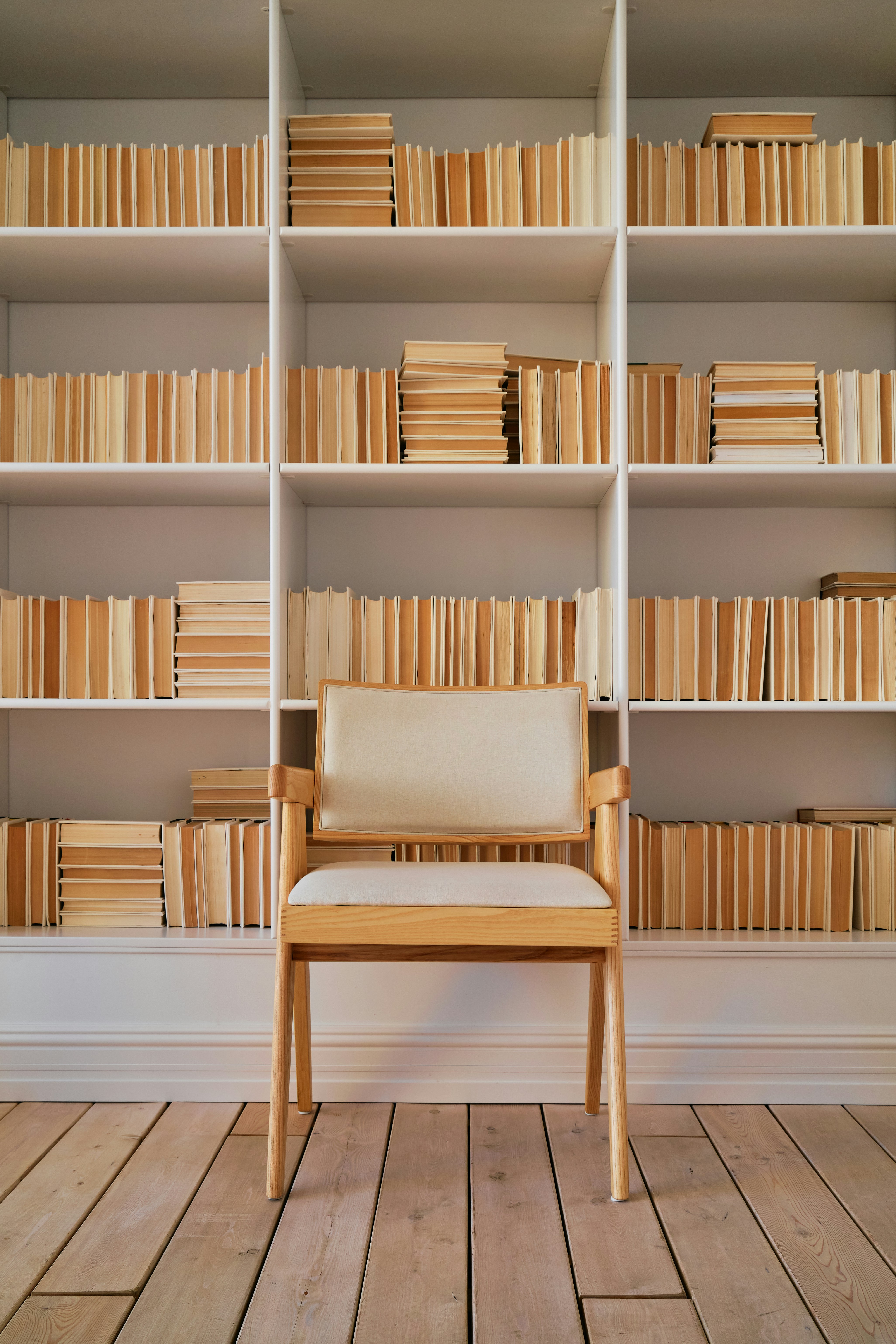


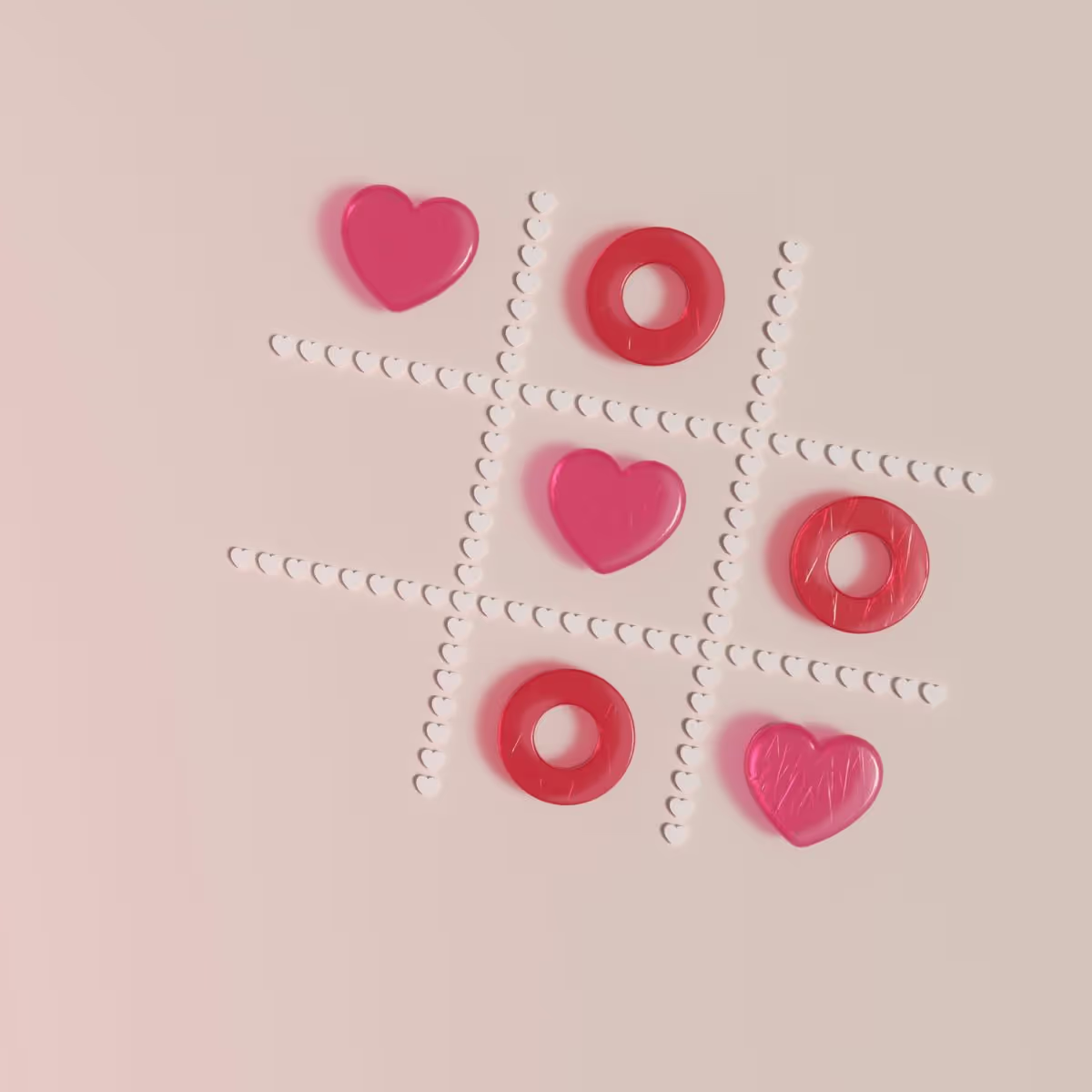
















.avif)







