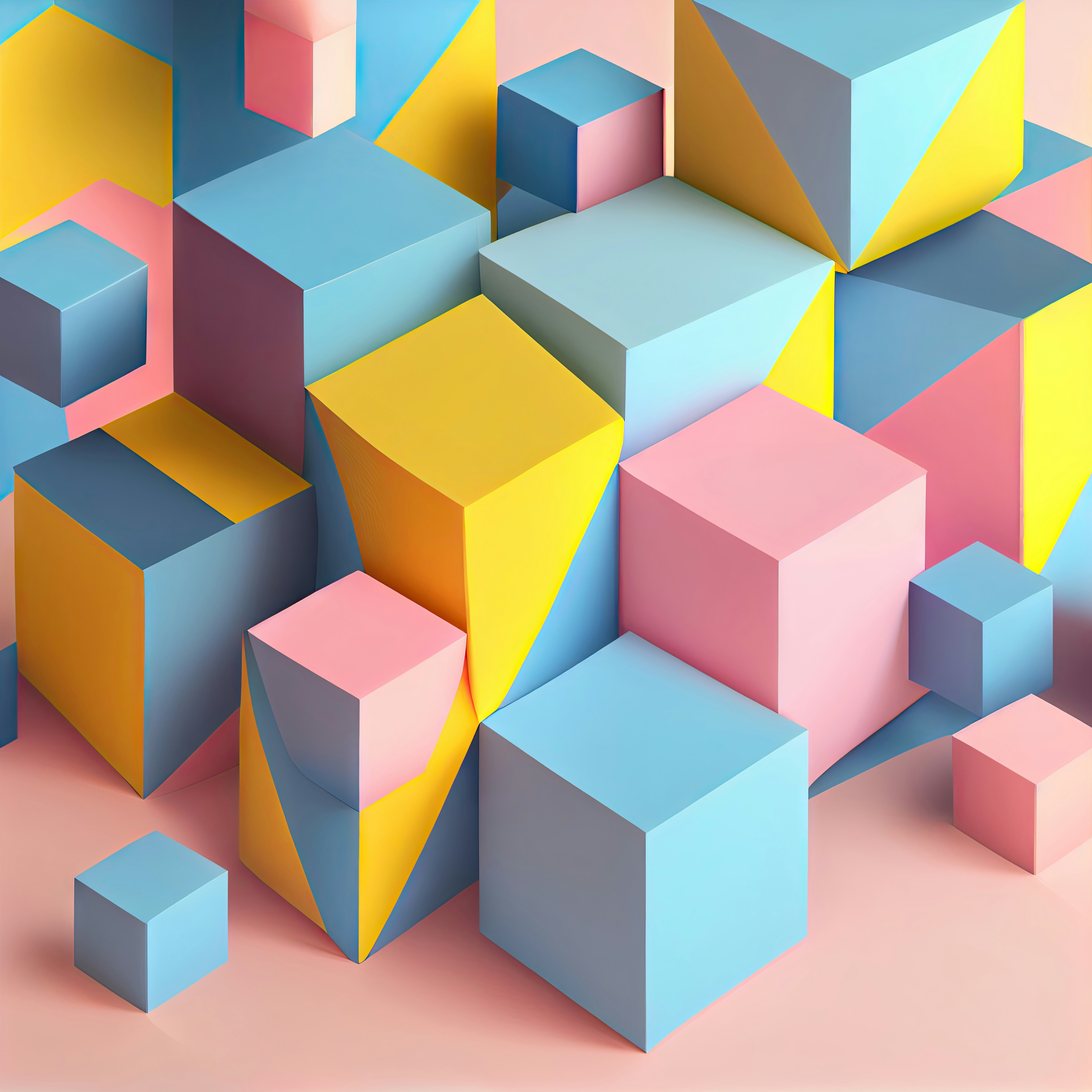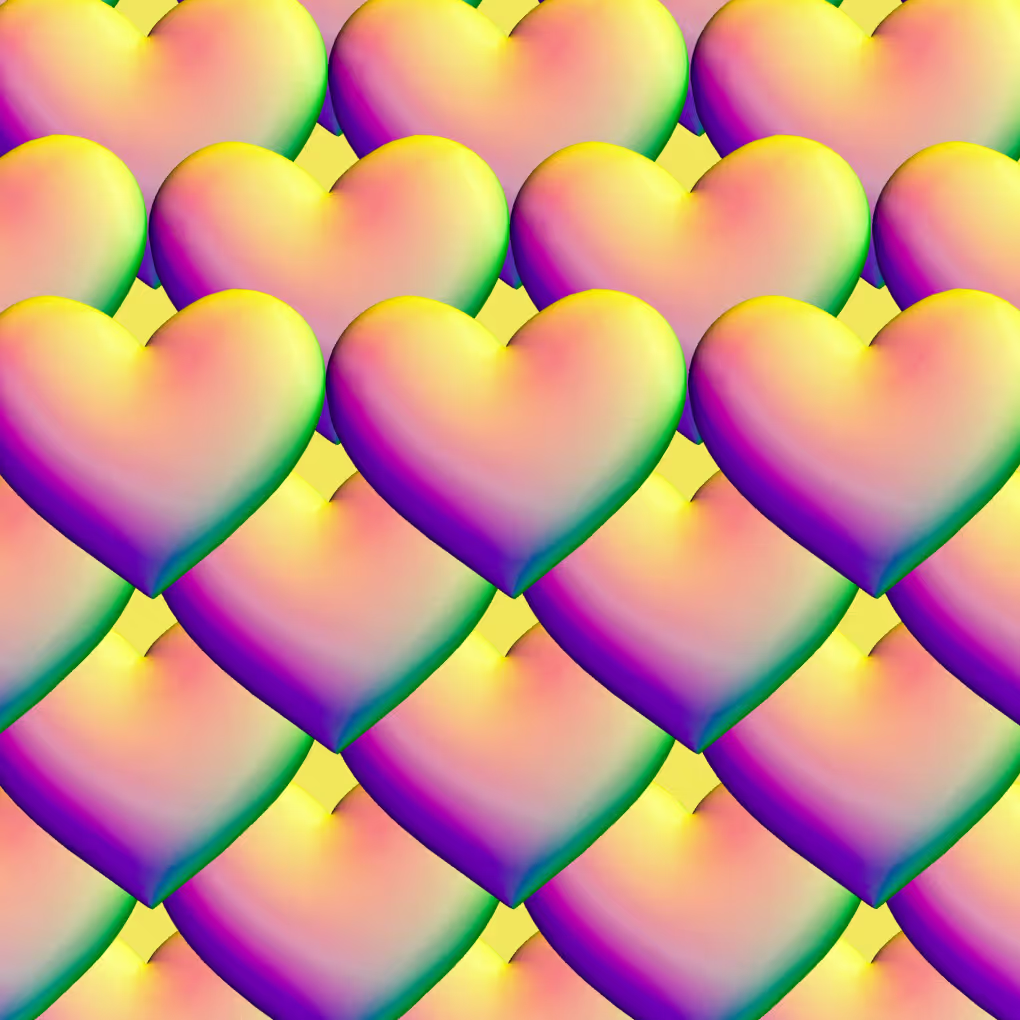Magazin
News und Wissen für dich: Hier erfährst du Neues aus der Welt von Faktor D und bekommst spannende Inputs von Expert*innen aus der Demokratiewelt.
Das neue demokratische Drehbuch: Warum wir mutiger, unbequemer und strategischer werden müssen
In ihrer Eröffnungskeynote bei Mitmacht 2025 in Wien macht Jeanette Gusko klar: Autoritäre Kräfte sind längst am Werk. Die Frage ist, ob wir schnell und mutig genug sind, wieder den Takt vorzugeben.
Eine Gesellschaft, die sich schützt
Oft sind herausfordernde emotionale Reaktionen das Ergebnis eines tiefsitzenden Überlebensimpulses von Menschen und ganzen Gesellschaften. Wir müssen diese Emotionen ernst nehmen – und dürfen gleichzeitig nicht in ihnen steckenbleiben, meint Maximilian Hempt.
Diese sieben Tipps machen (kommunale) Beteiligung besser
Klassische Beteiligungsformate erreichen oft nur die „üblichen Verdächtigen“, sagt Andreas Meinlschmidt. Hier schlägt er vor, wie ein Perspektivwechsel auf bisher wenig erreichte Zielgruppen gelingen kann.
Nur keine Angst vor Fehlern
Um Gefühle wie Angst und Scham zu vermeiden, ist die Unternehmerin, Aktivistin und Autorin Lisa Jaspers lange einer Vermeidungsstrategie gefolgt. Jetzt weiß sie: Kritik ist nicht das Ende, sondern ein Anfang.
News von Faktor D
Das war Mitmacht 2025
Wien wurde zum Treffpunkt demokratischer Zukunft: Beim Mitmacht-Festival vernetzten sich über 200 Teilnehmende in rund 50 Veranstaltungen für eine gemeinsame Agenda.
News vom Mitmacht-Festival
News & Wissen aus Mission #1
News & Wissen aus Mission #2
News & Wissen aus Mission #3
News & Wissen aus Mission #4
Aus unseren Veranstaltungen
Spannende Inputs von Expert*innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz
Diese Expert*innen haben schon ihr Wissen geteilt
Nichts verpassen
Abonniere unseren Newsletter und erfahre stets das Neueste zu unseren Angeboten.























.jpg)